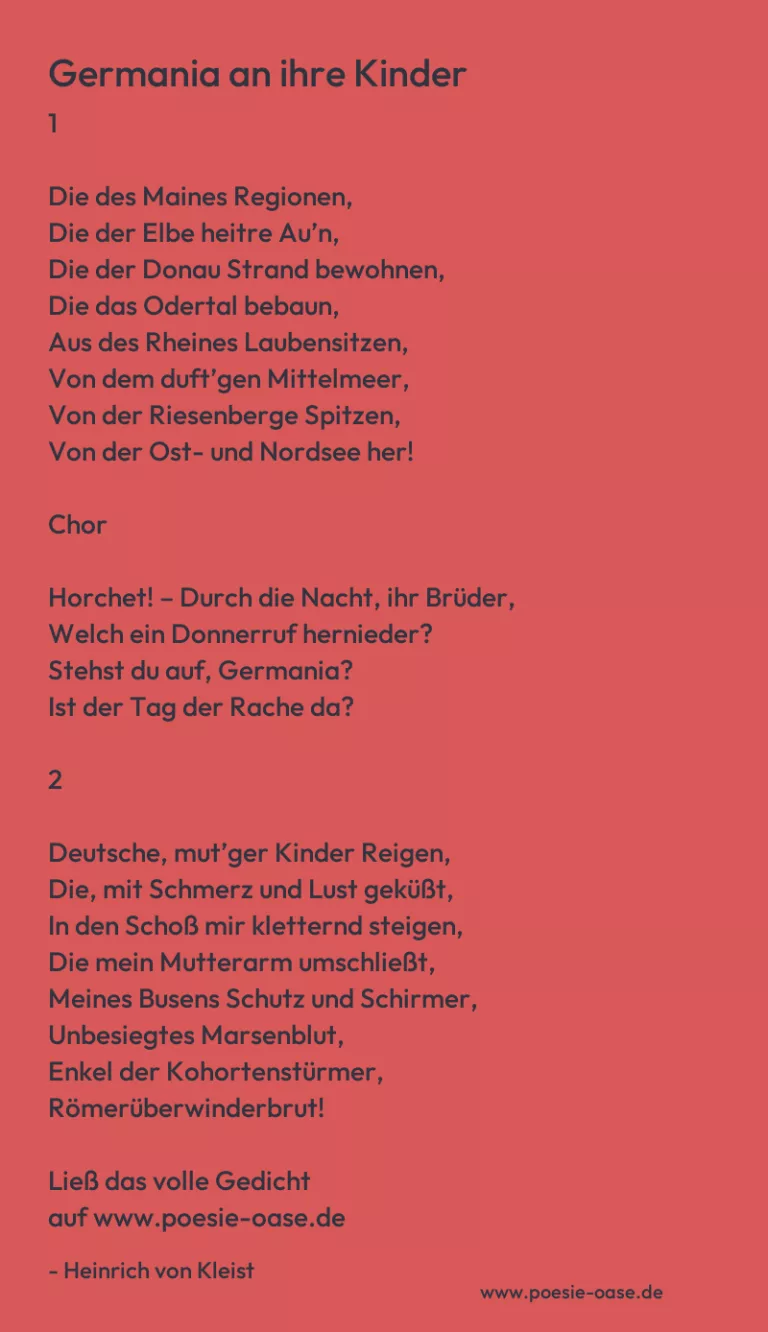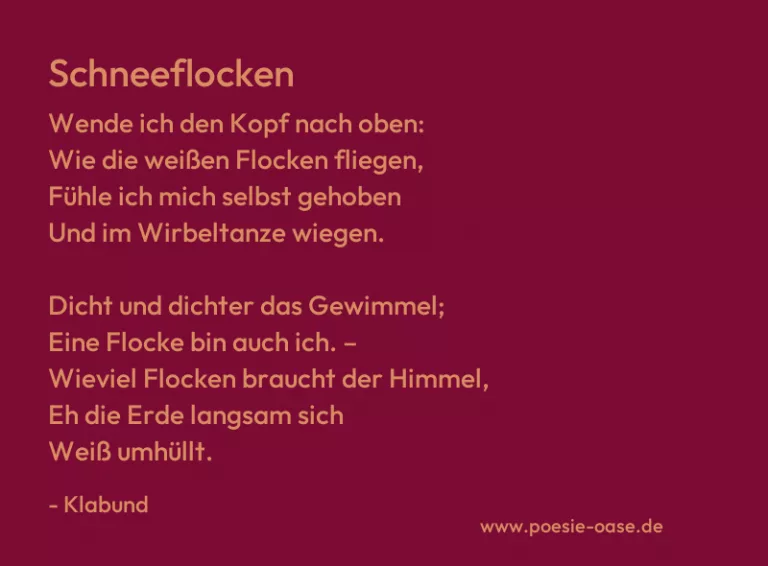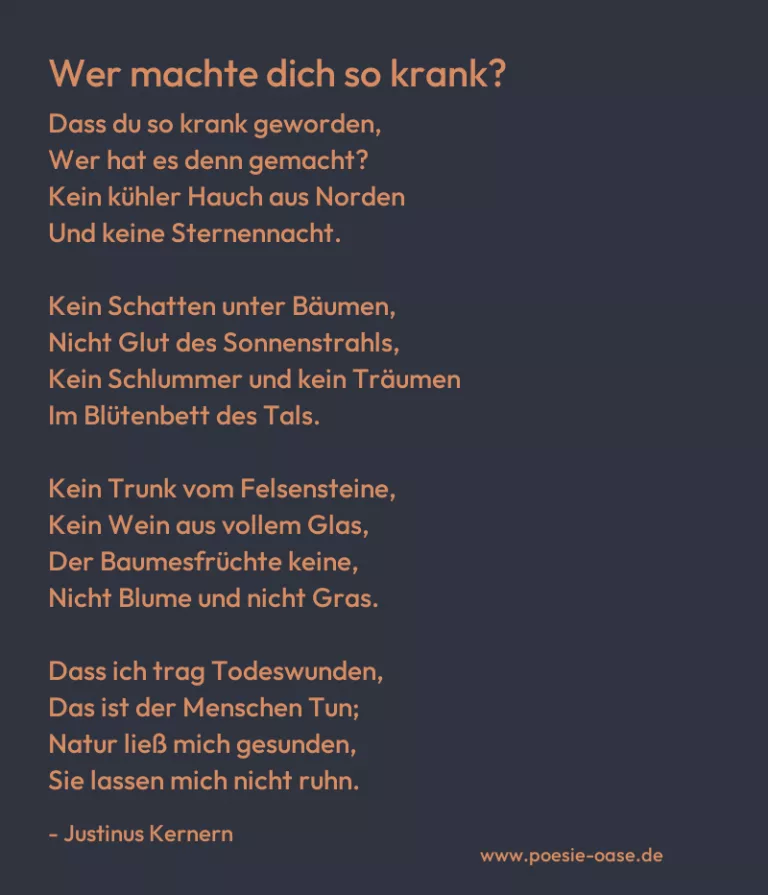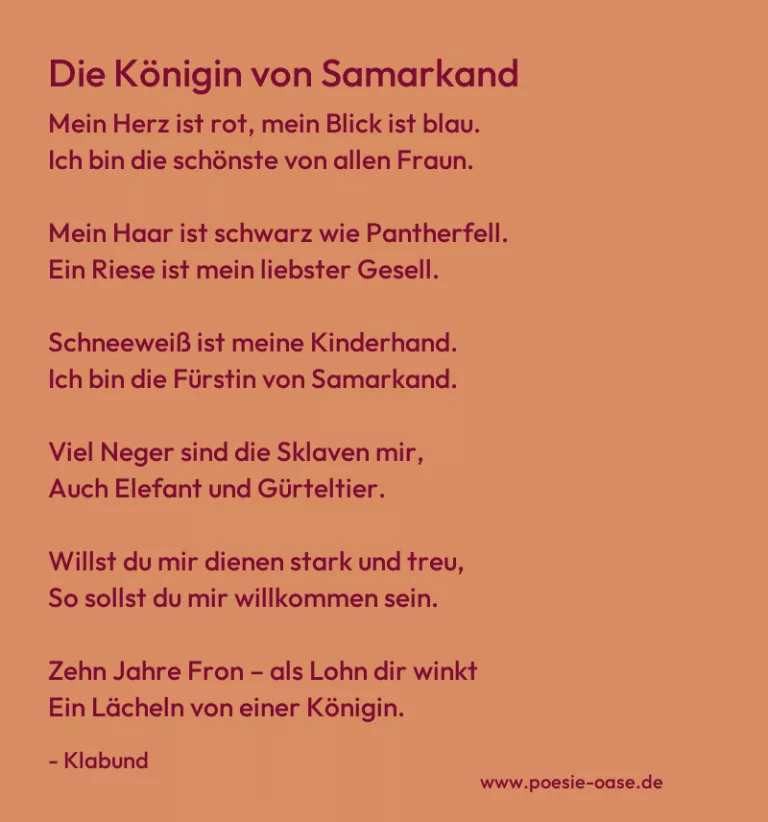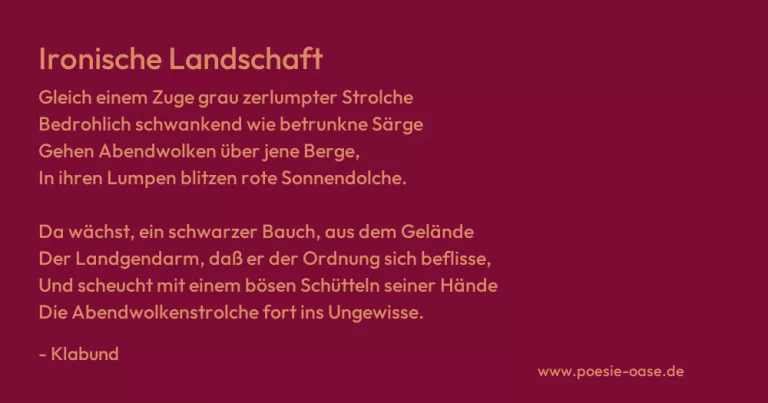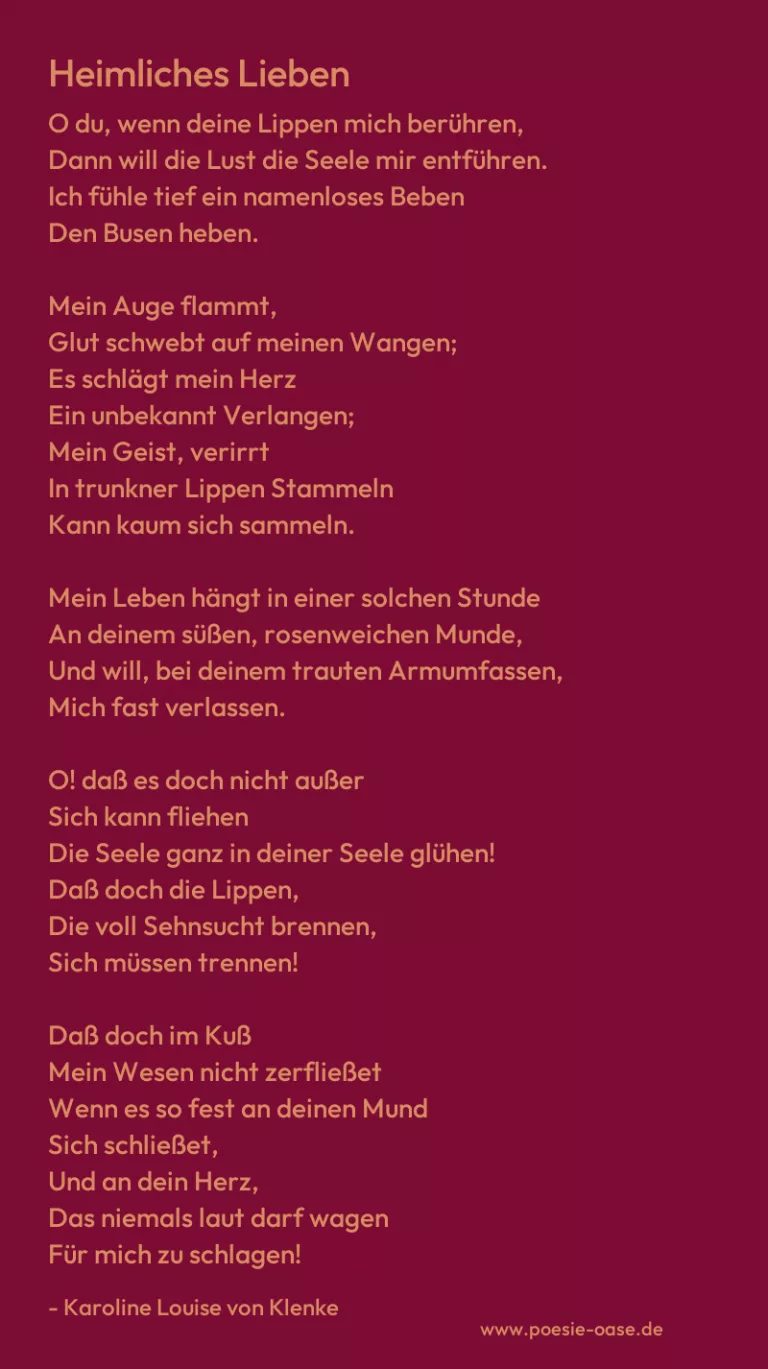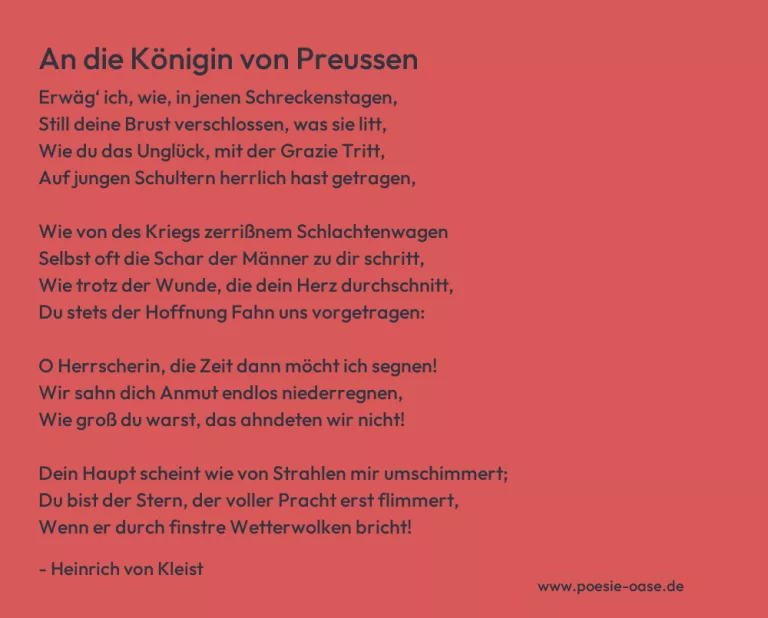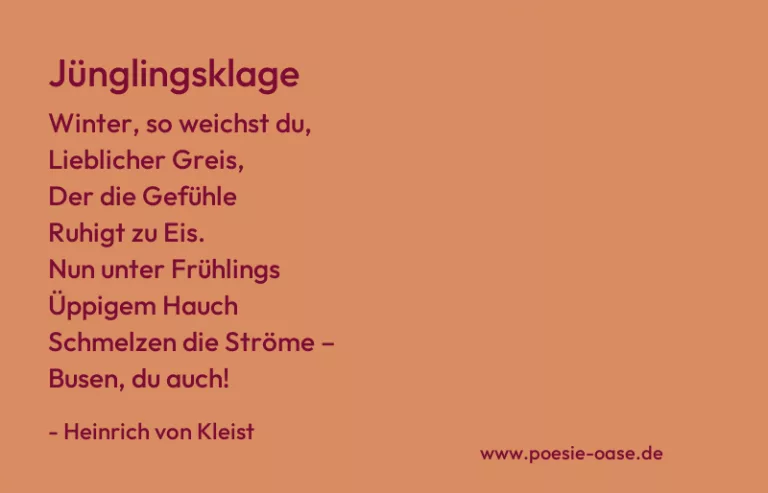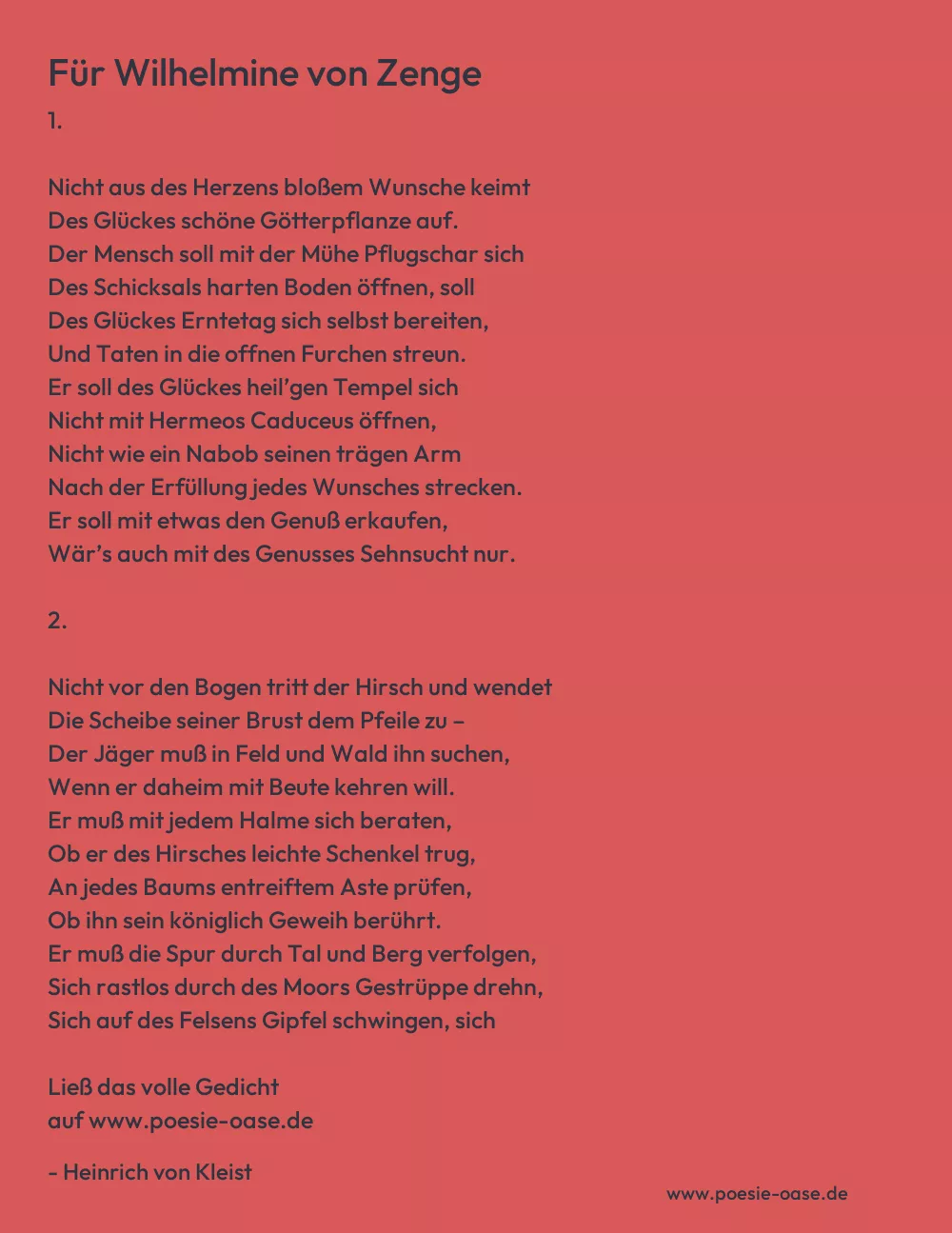1.
Nicht aus des Herzens bloßem Wunsche keimt
Des Glückes schöne Götterpflanze auf.
Der Mensch soll mit der Mühe Pflugschar sich
Des Schicksals harten Boden öffnen, soll
Des Glückes Erntetag sich selbst bereiten,
Und Taten in die offnen Furchen streun.
Er soll des Glückes heil’gen Tempel sich
Nicht mit Hermeos Caduceus öffnen,
Nicht wie ein Nabob seinen trägen Arm
Nach der Erfüllung jedes Wunsches strecken.
Er soll mit etwas den Genuß erkaufen,
Wär’s auch mit des Genusses Sehnsucht nur.
2.
Nicht vor den Bogen tritt der Hirsch und wendet
Die Scheibe seiner Brust dem Pfeile zu –
Der Jäger muß in Feld und Wald ihn suchen,
Wenn er daheim mit Beute kehren will.
Er muß mit jedem Halme sich beraten,
Ob er des Hirsches leichte Schenkel trug,
An jedes Baums entreiftem Aste prüfen,
Ob ihn sein königlich Geweih berührt.
Er muß die Spur durch Tal und Berg verfolgen,
Sich rastlos durch des Moors Gestrüppe drehn,
Sich auf des Felsens Gipfel schwingen, sich
Hinab in tiefer Schlünde Absturz stürzen,
Bis in der Wildnis dicksten Mitternacht,
Er kraftlos neben seiner Beute sinkt.
3.
Der Schwalbe Nest hangt an des Knaben Hütte,
Allein die leichte Beute reizt ihn nicht.
Er will des Adlers königliche Brut,
Die in der Eiche hohem Wipfel thronet.
Denn das Erworbne – wär’s mit einem Tropfen Schweiß
Auch nur erworben, ist uns mehr, als das
Gefundne wert. Den wir mit unsers Lebens
Gefahr erretteten, der ist uns teuer,
So wie dem Araber der teuer ist,
Dem er ein Stück von seinem Brote gab.
4.
Am Ufer glänzt die helle Perlemutter,
Und des Agats buntfarbiges Gestein;
Allein der Perlenfischer achtet
Nicht was die Erde bietet, stürzt
Sich lieber in des Meeres Wogen, senkt
Sich nieder in die dunkle Tiefe, und
Kehrt stolzer, als der Bergmann mit dem Golde,
Mit einer Auster blassem Schleim zurück.
5.
Den Bergmann soll die Wünschelrute nicht
Mit blindem Glück an goldne Schätze führen,
Er soll durch Erd und Stein sich einen Weg
Bis zu des Erzes edlem Gange bahnen,
Damit er an dem Körnchen Gold, das er
Mit Schweiß erwarb, sich mehr, als an dem Schatze,
Den ihm die Wünschelrute zeigt, erfreue.
6.
Des Künstlers Meißel übt sich an Kristallen,
Die schon von selbst mit Farben spielen, nicht.
Er übt sich an dem rohen Kiesel, den
Des Knaben Fußtritt nicht verschonte, wühlet
Sich durch die Rinde, lockt den Feuerfunken,
Der in des Kiesels kaltem Busen schlummert,
In tausend Blitzen aus dem Stein hervor,
Und schmückt mit ihm der Herrscher Diadem.
7.
Nicht zu dem Schiffer schwimmet, aus der Ferne,
Des Indiers goldner Ueberfluß heran,
Er muß auf ungewissen Brettern sich
Dem trügerischen Meere anvertraun.
Er muß der Sandbank hohe Fläche meiden,
Der Klippe spitzgeschliffnen Dolch umgehn,
Sich mühsam durch der Meere Strudel winden,
Mit Stürmen kämpfen, sich mit Wogen schlagen,
Bis ihn der Küste sichrer Port empfängt.
8.
Auch zu der Liebe schwimmt nicht stets das Glück,
Wie zu dem Kaufmann nicht der Indus schwimmt.
Sie muß sich ruhig in des Lebens Schiff,
Des Schicksals wildem Meere anvertraun,
Dem Wind des Zufalls seine Segel öffnen,
Es an der Hoffnung Steuerruder lenken,
Und stürmt es, vor der Treue Anker gehn.
Sie muß des Wankelmutes Sandbank meiden,
Geschickt des Mißtrauns spitzen Fels umgehn,
Und mit des Schicksals wilden Wogen kämpfen,
Bis in des Glückes sichern Port sie läuft.