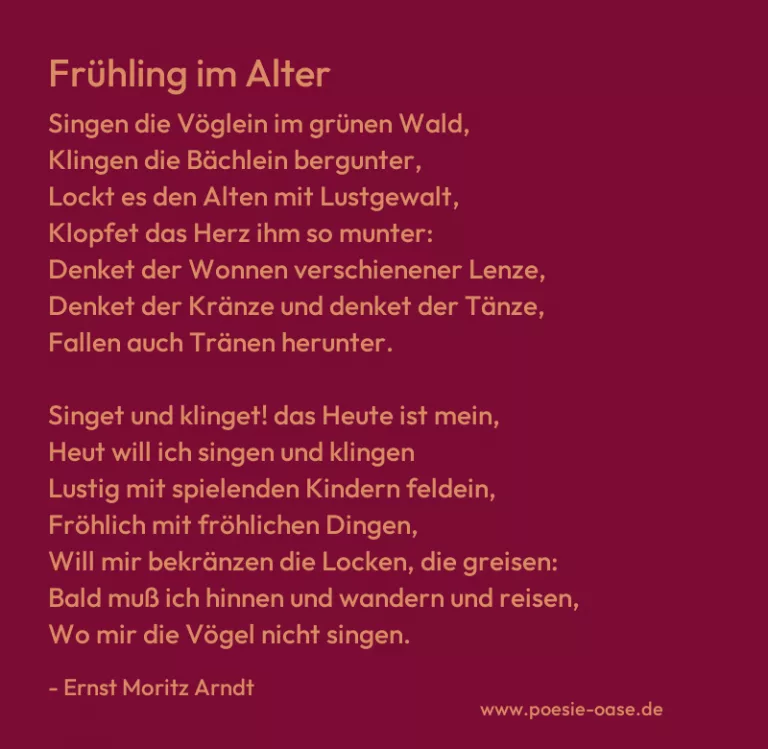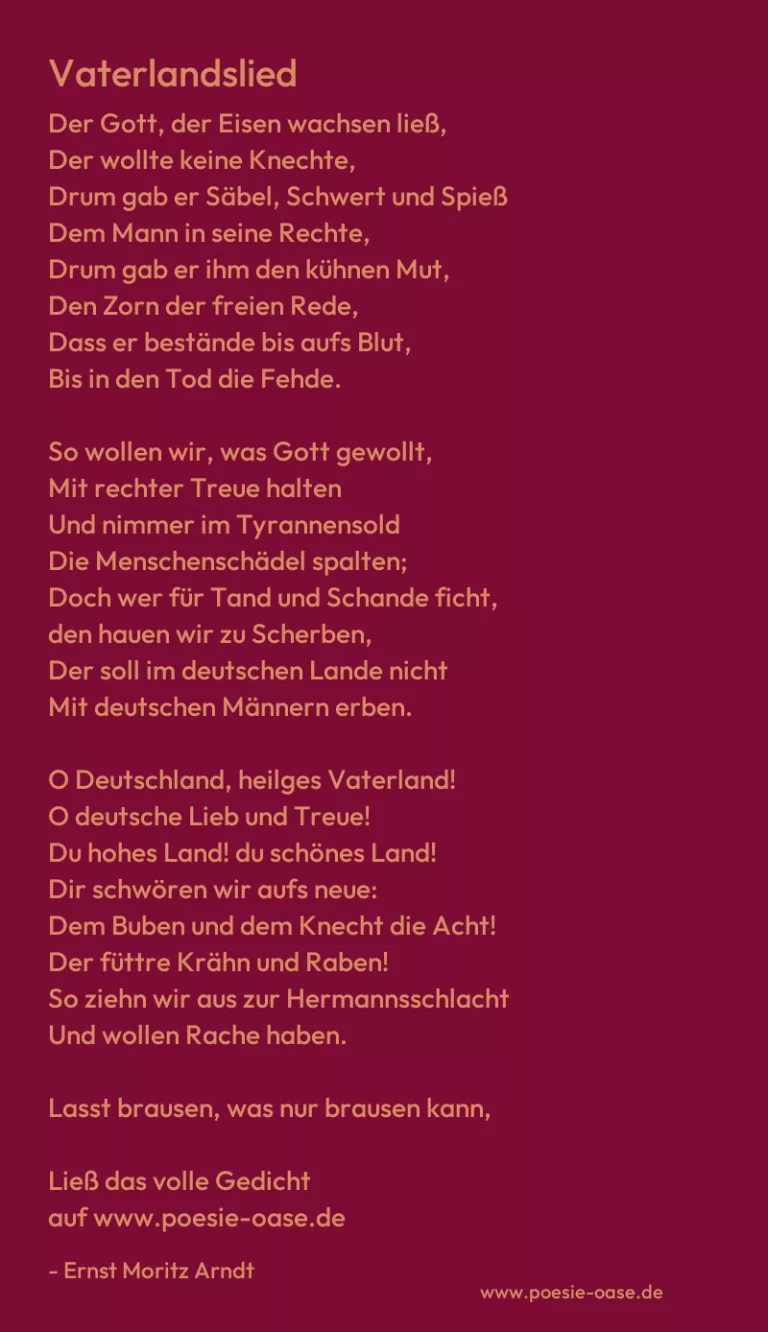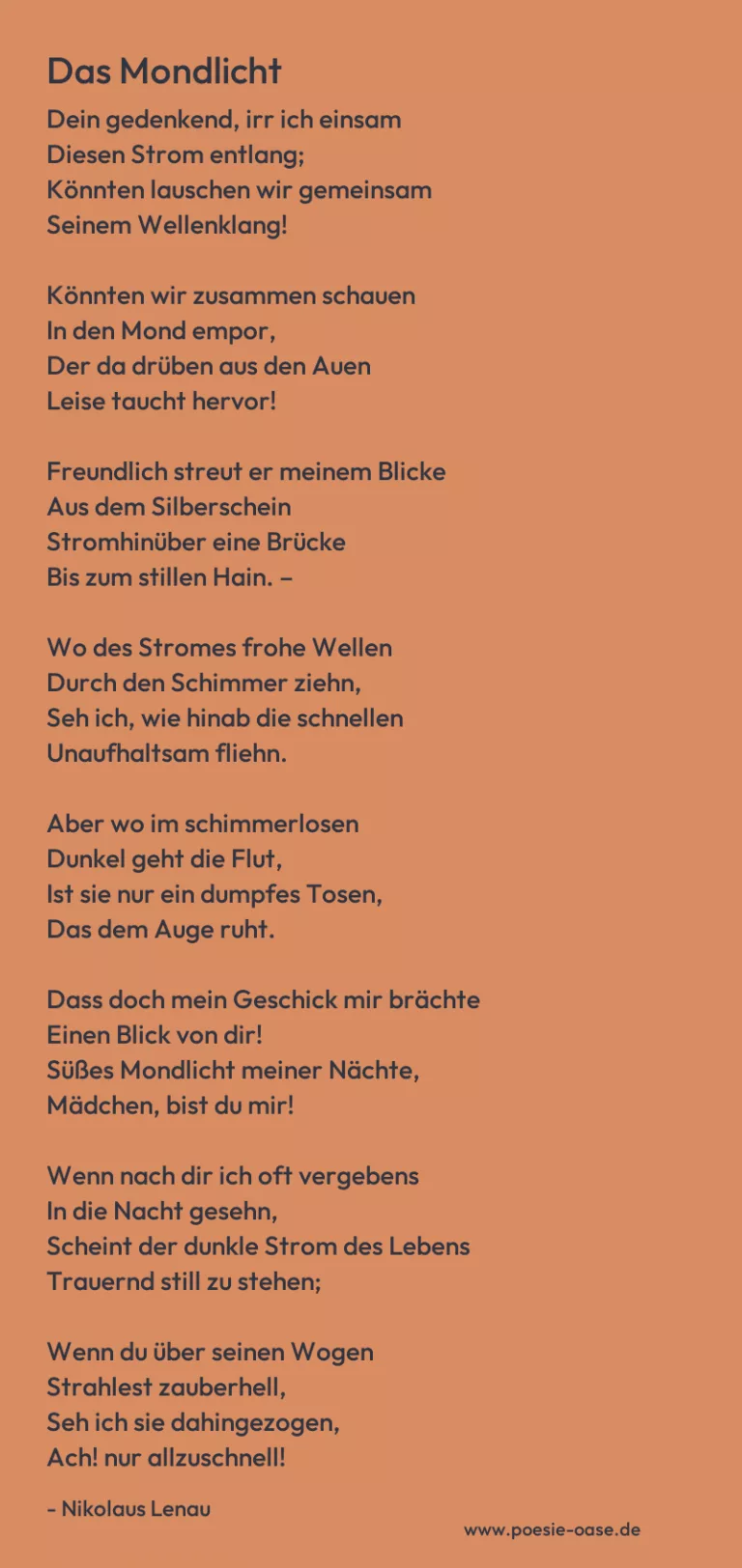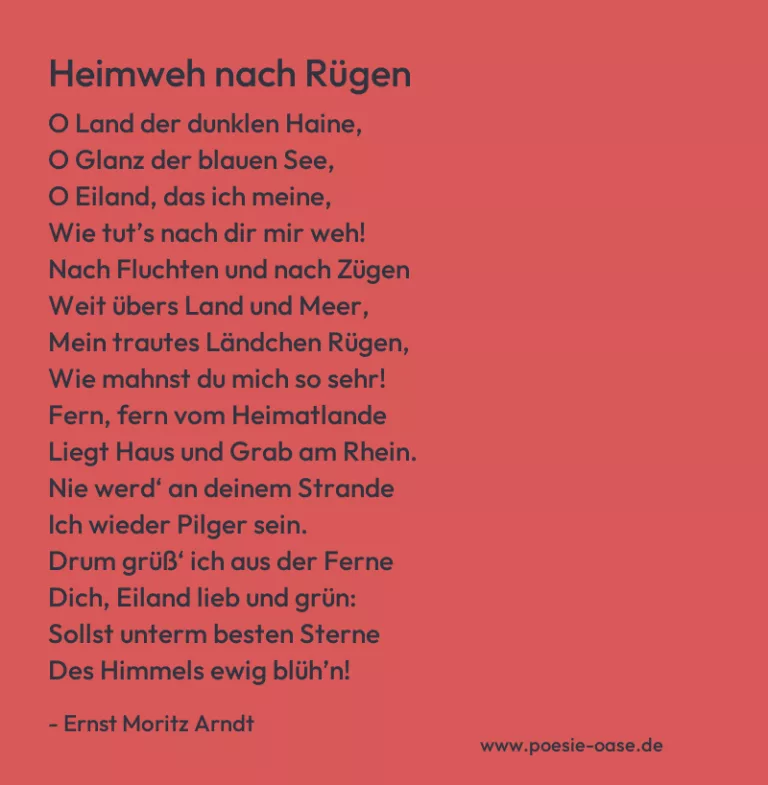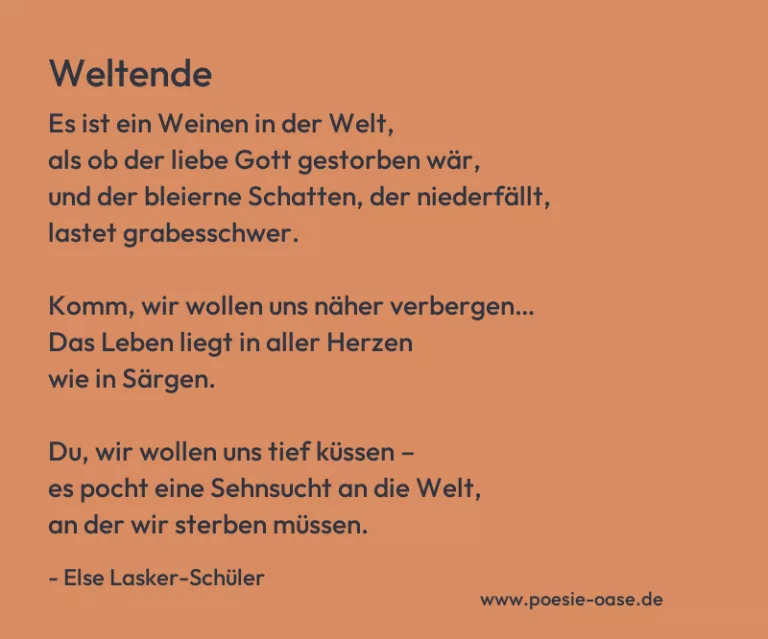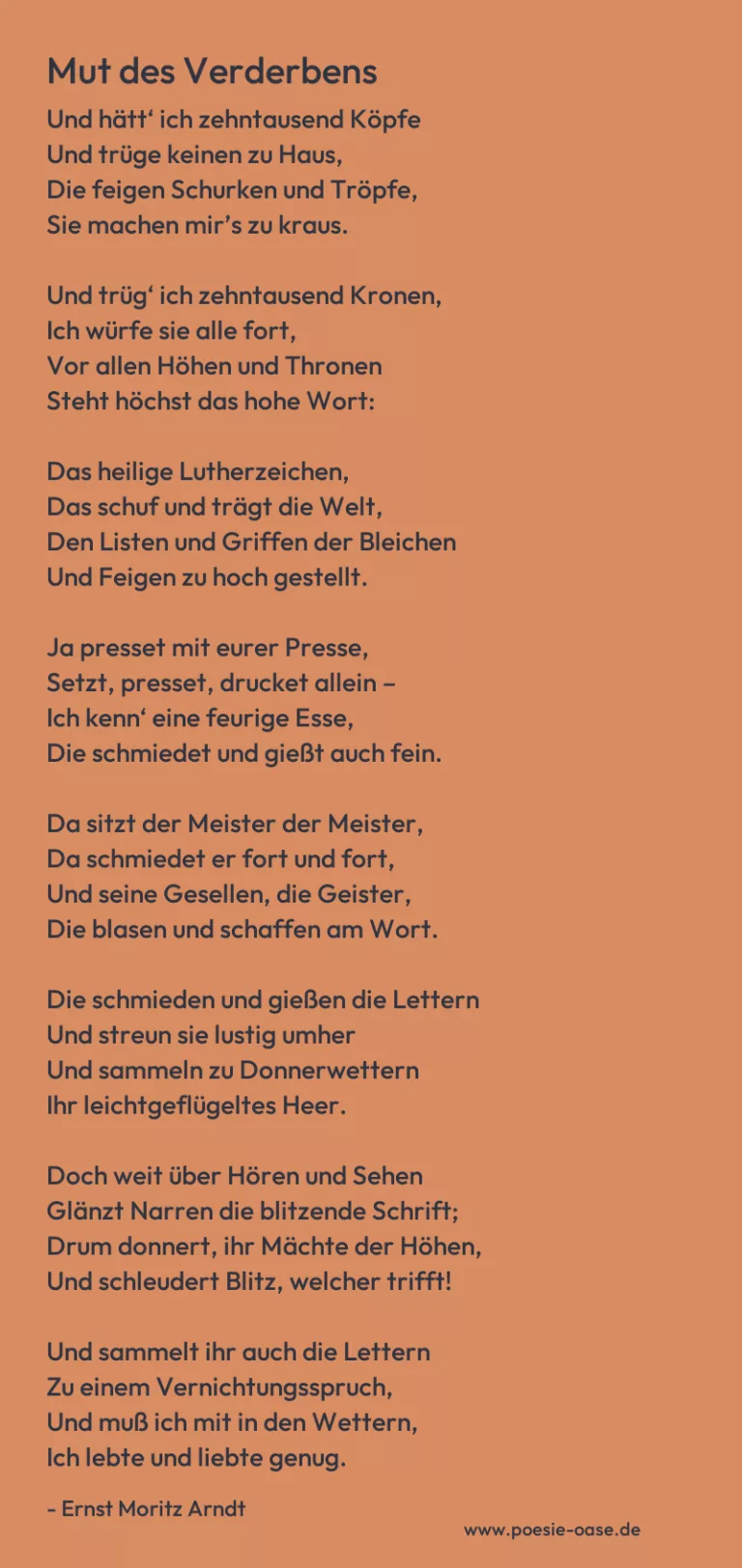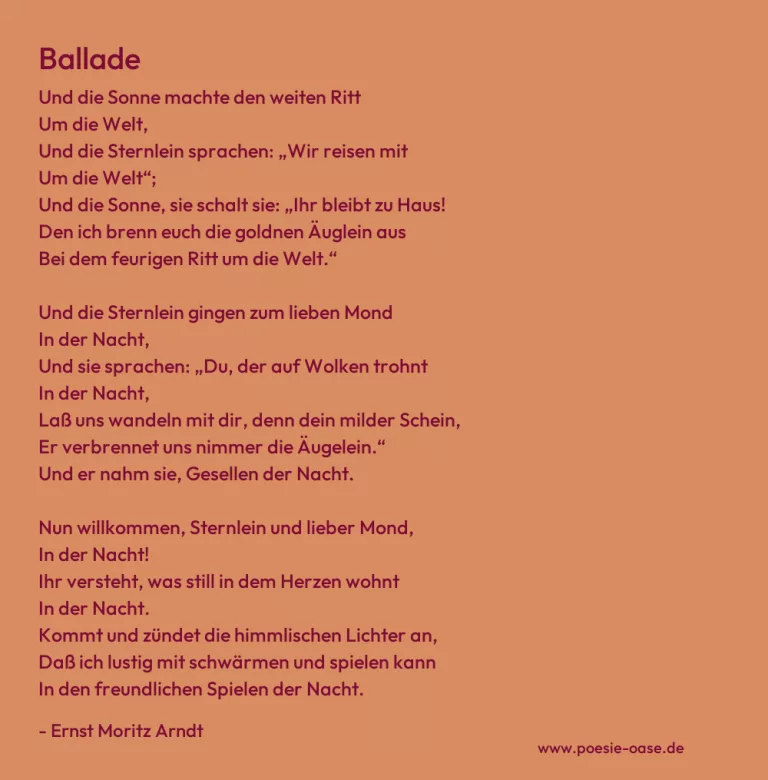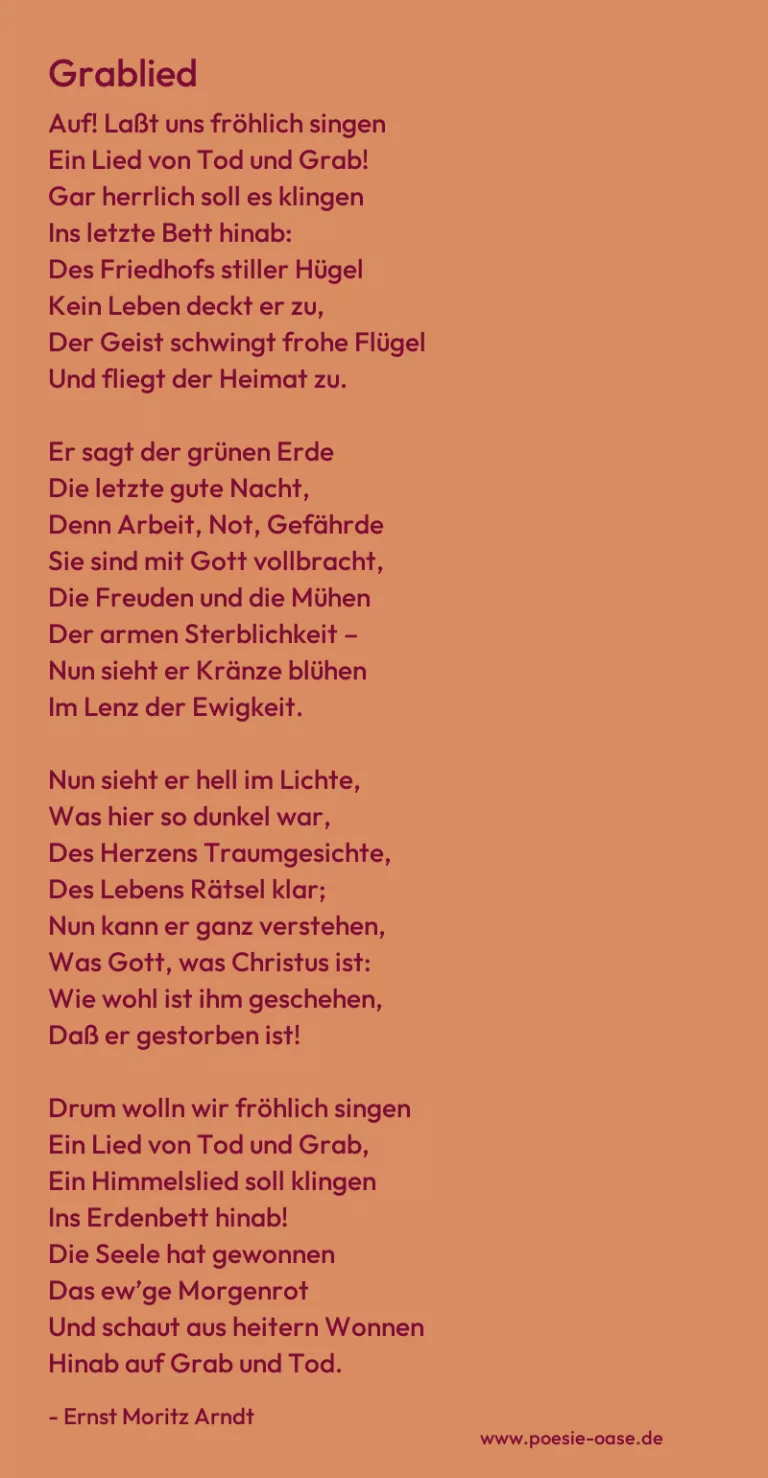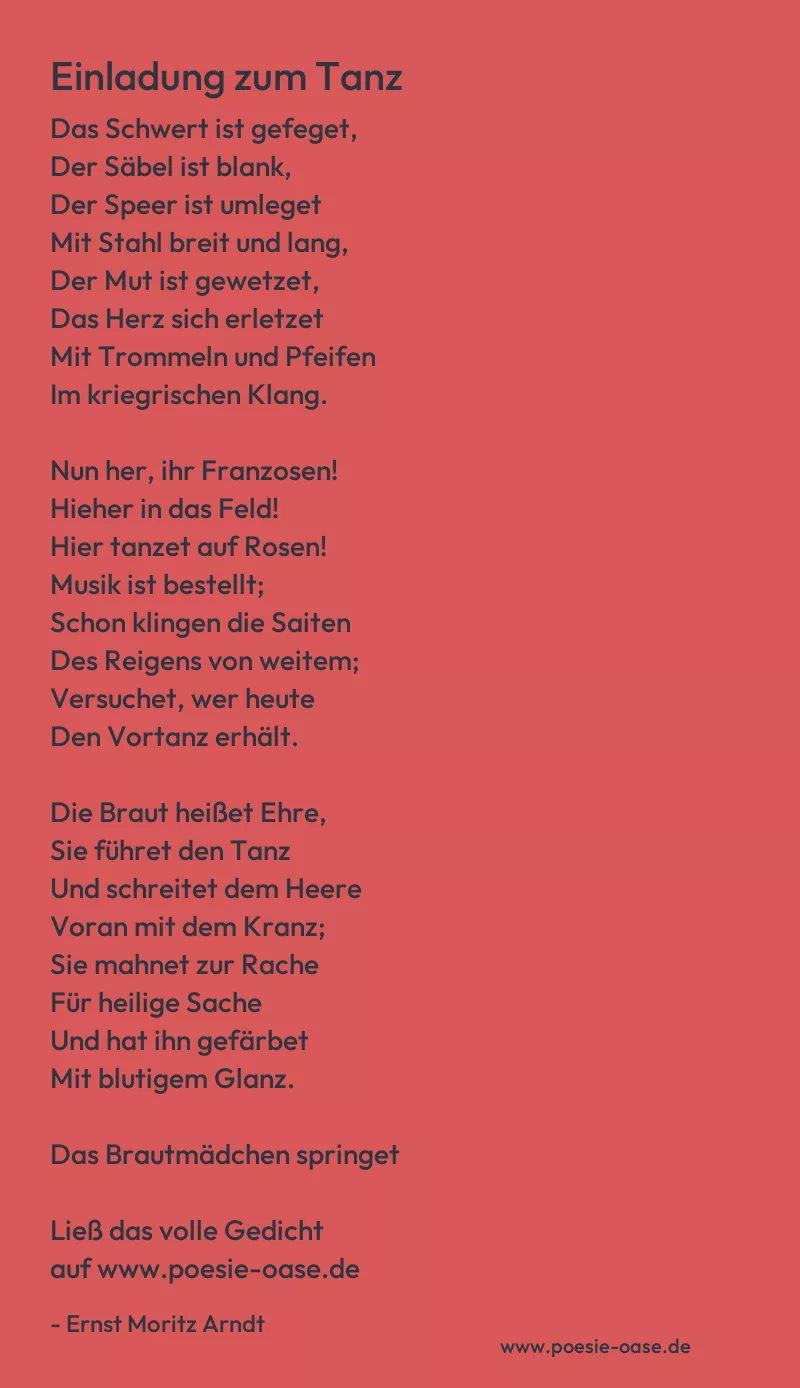Das Schwert ist gefeget,
Der Säbel ist blank,
Der Speer ist umleget
Mit Stahl breit und lang,
Der Mut ist gewetzet,
Das Herz sich erletzet
Mit Trommeln und Pfeifen
Im kriegrischen Klang.
Nun her, ihr Franzosen!
Hieher in das Feld!
Hier tanzet auf Rosen!
Musik ist bestellt;
Schon klingen die Saiten
Des Reigens von weitem;
Versuchet, wer heute
Den Vortanz erhält.
Die Braut heißet Ehre,
Sie führet den Tanz
Und schreitet dem Heere
Voran mit dem Kranz;
Sie mahnet zur Rache
Für heilige Sache
Und hat ihn gefärbet
Mit blutigem Glanz.
Das Brautmädchen springet
So tapfer daher,
Heißt Freiheit und schwinget
Den mächtigen Speer;
Sie kann nicht erbleichen,
Auf Trümmern und Leichen
Da führt sie als Heldin
Das vorderste Heer.
Drum frisch, Kameraden!
Wer greifet den Kranz?
Seid alle geladen
Zum Spiel und zum Tanz;
Die Trommeln erklingen,
Die Fahnen sich schwingen –
Juchheisa! Juchheisa!
Zum lustigen Tanz!