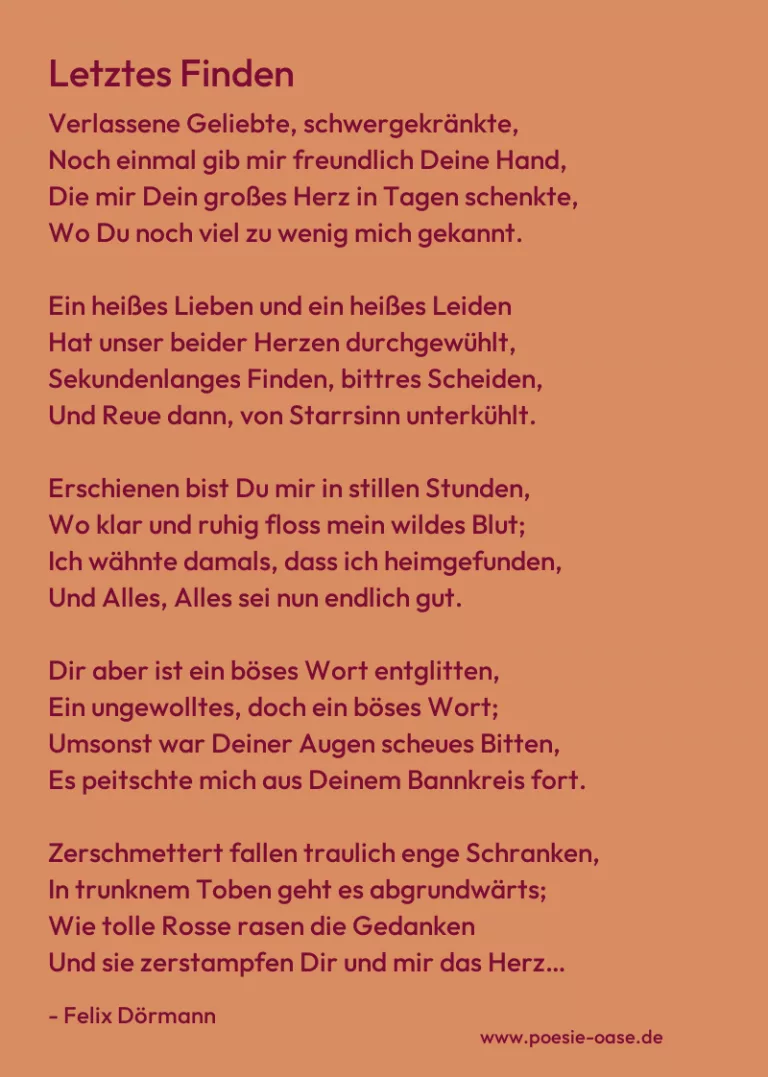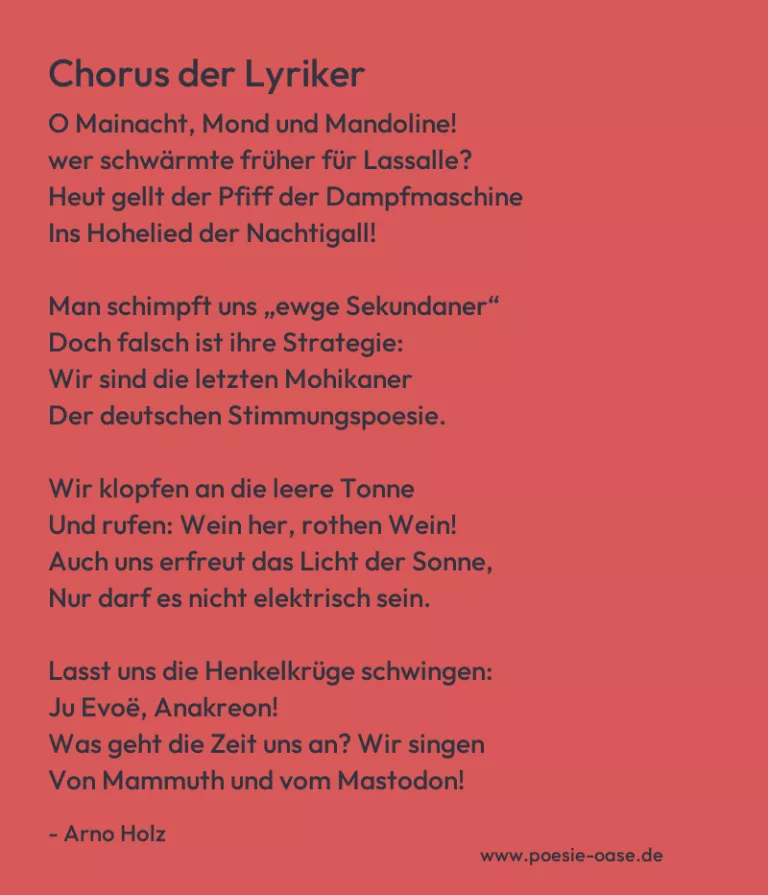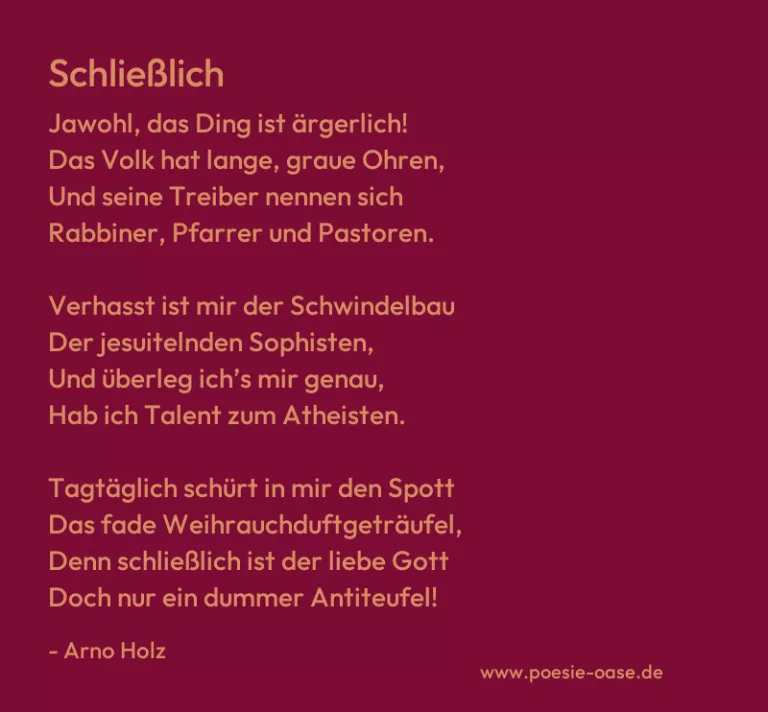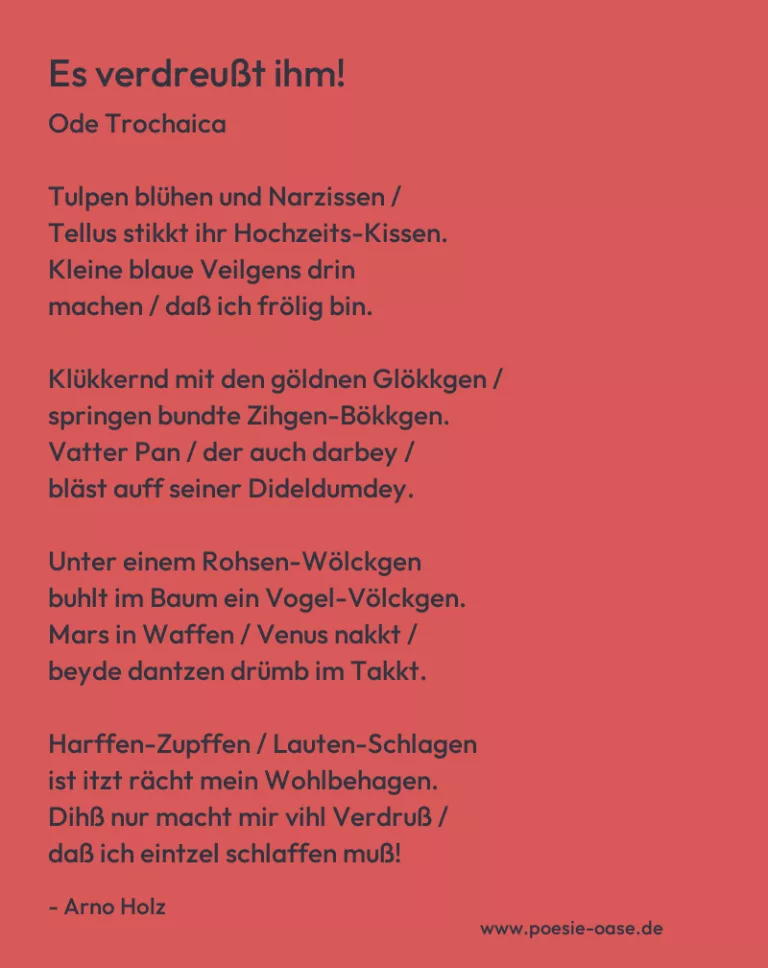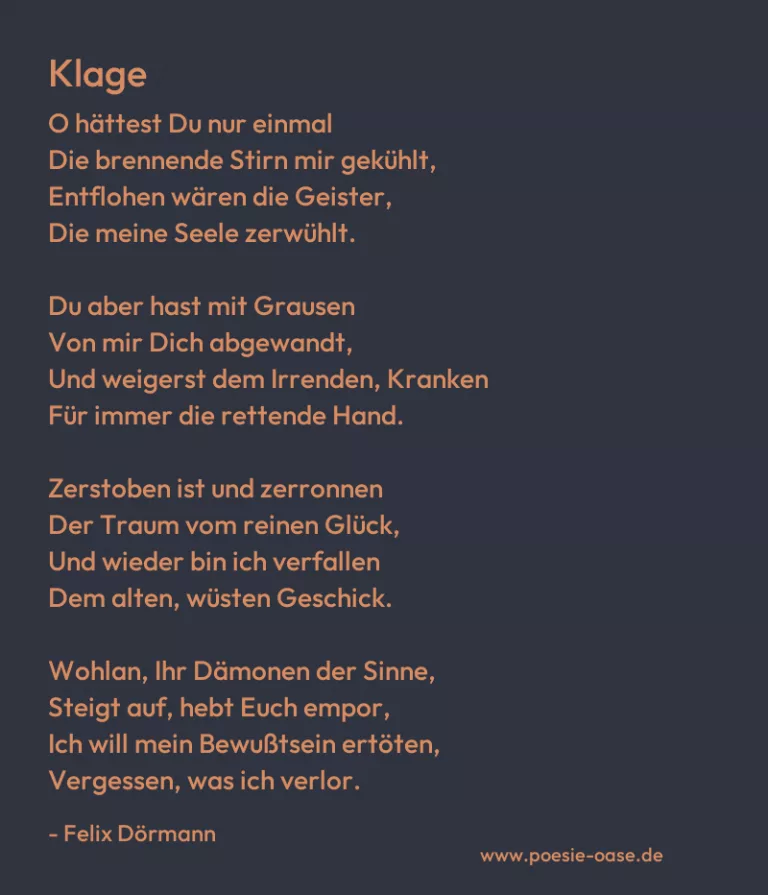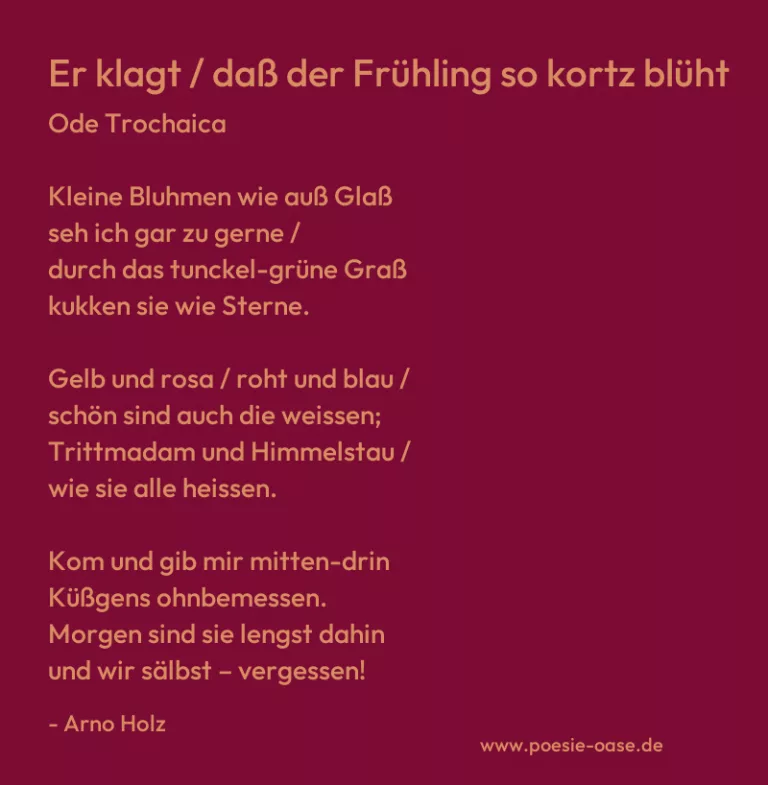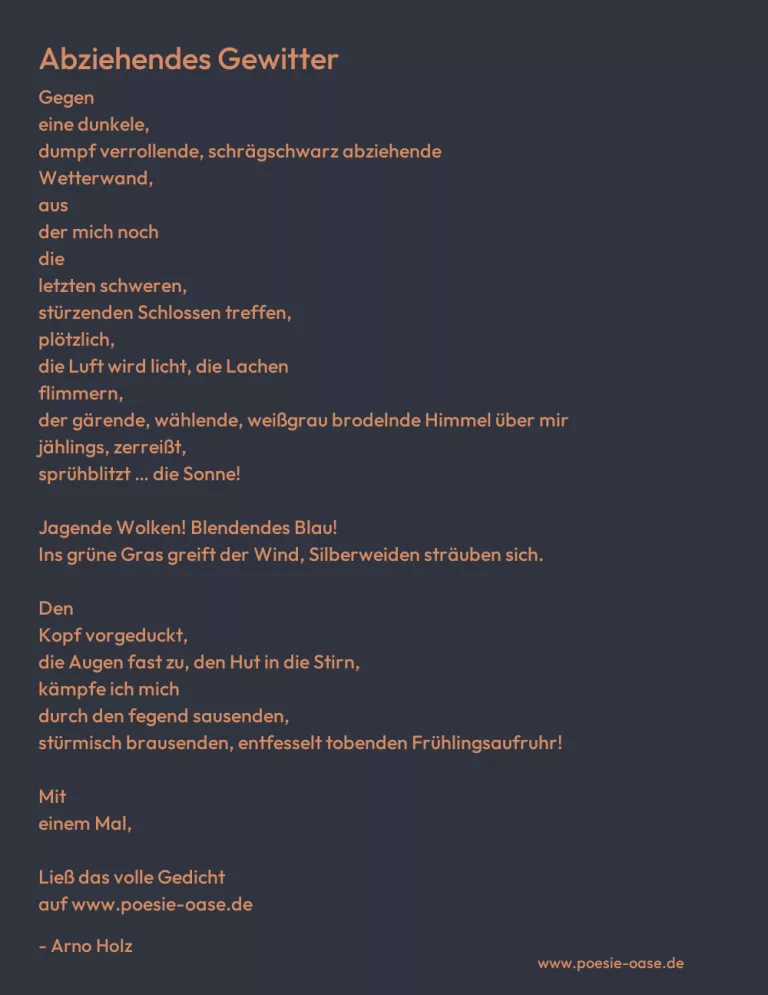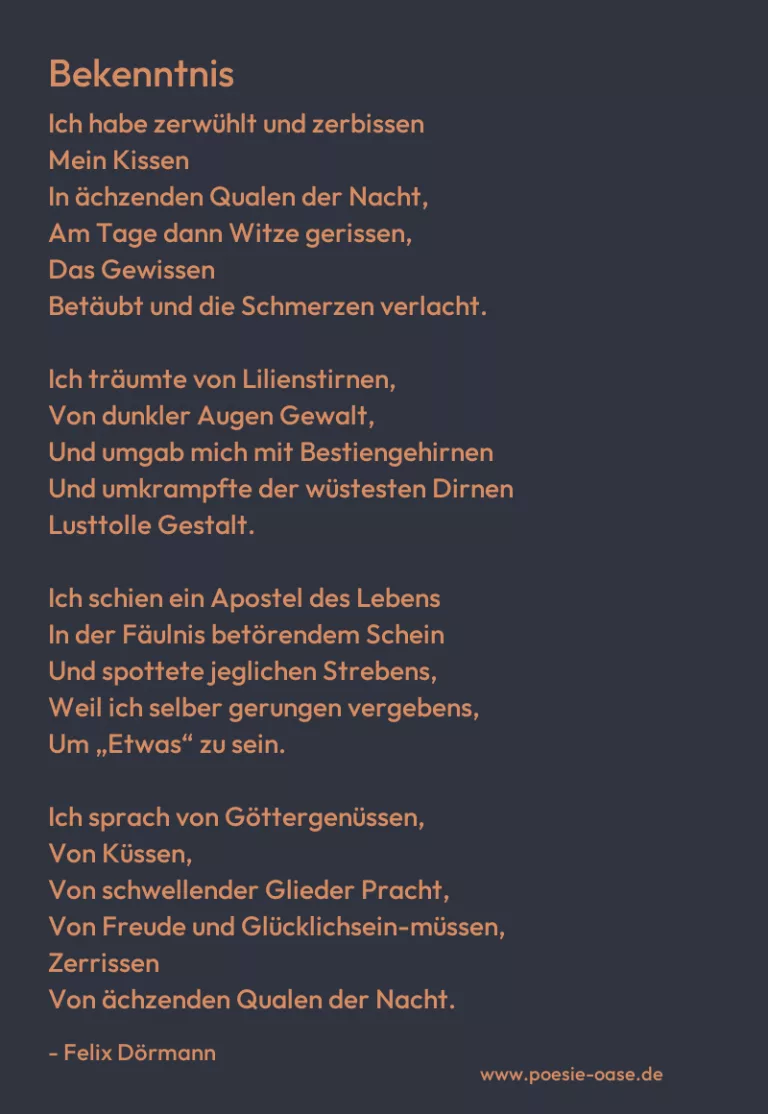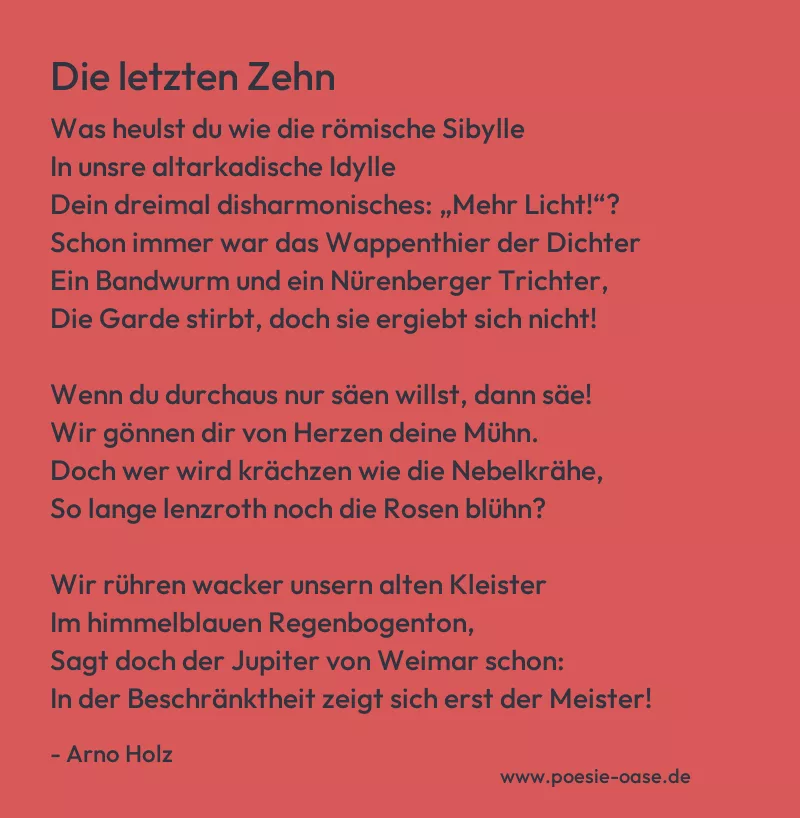Die letzten Zehn
Was heulst du wie die römische Sibylle
In unsre altarkadische Idylle
Dein dreimal disharmonisches: „Mehr Licht!“?
Schon immer war das Wappenthier der Dichter
Ein Bandwurm und ein Nürenberger Trichter,
Die Garde stirbt, doch sie ergiebt sich nicht!
Wenn du durchaus nur säen willst, dann säe!
Wir gönnen dir von Herzen deine Mühn.
Doch wer wird krächzen wie die Nebelkrähe,
So lange lenzroth noch die Rosen blühn?
Wir rühren wacker unsern alten Kleister
Im himmelblauen Regenbogenton,
Sagt doch der Jupiter von Weimar schon:
In der Beschränktheit zeigt sich erst der Meister!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
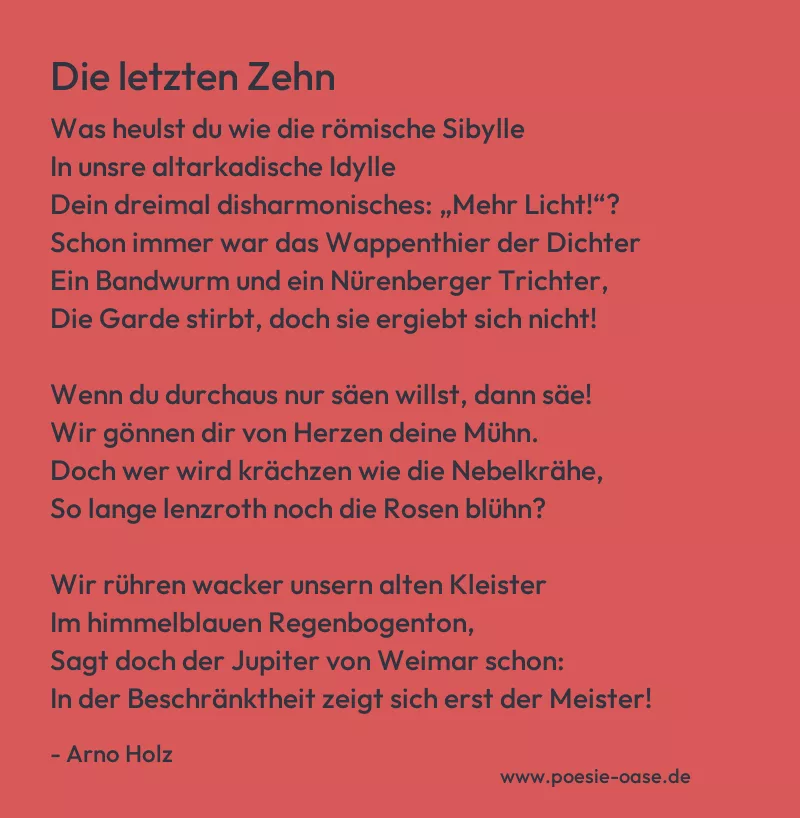
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die letzten Zehn“ von Arno Holz spielt mit einer Vielzahl an kulturellen und literarischen Anspielungen und ist zugleich ein satirischer Kommentar zu den Herausforderungen und Eigenheiten des Dichterseins. Die erste Strophe stellt den Sprecher als kritischen Beobachter dar, der sich über die „römische Sibylle“, eine prophetische Figur, die in der Antike das Orakel sprach, und deren „dreimal disharmonisches: ‚Mehr Licht!‘“ empört. Das Zitat „Mehr Licht!“ verweist auf den Ruf von Goethe, der damit auf eine Erleuchtung oder Aufklärung hinwies – in diesem Fall jedoch wird es als unpassend und störend empfunden, um die „altarkadische Idylle“ zu bewahren, die die Idylle der Dichtung symbolisiert.
In der zweiten Strophe geht es um die Diskrepanz zwischen den Idealen der Dichtung und der Realität des poetischen Schaffens. Der Vergleich mit dem „Bandwurm“ und dem „Nürnberger Trichter“ deutet auf die langatmige, sich wiederholende und oft wenig fruchtbare Natur des kreativen Prozesses hin. Diese Metaphern spielen auf eine quälende und zermürbende Arbeit an, die – obwohl sie nie aufgibt – dennoch nicht zu den erhofften Ergebnissen führt. Die Dichtkunst ist hier als ständiger Kampf dargestellt, in dem der Dichter unermüdlich arbeitet, obwohl der Lohn oft nur schwer fassbar bleibt.
In der dritten Strophe wird das Bild des „krächzenden Nebels“ verwendet, um die Bedeutungslosigkeit von allzu kläglichen Versuchen, die natürliche Pracht zu übertrumpfen, zu kritisieren. Es scheint ein ironischer Verweis auf die Poetik des Dichters zu sein, der sich verzweifelt bemüht, die „Rosen“ – die symbolische Blüte der Dichtung – zu bewahren, obwohl alles seiner Meinung nach gegen diese Bemühung spricht. Die Zeile „Wer wird krächzen wie die Nebelkrähe?“ stellt einen ironischen Widerstand gegen den Ruf nach „Mehr Licht!“, was den romantischen Drang nach Erleuchtung oder Wahrheit kritisiert.
In der abschließenden Strophe wird die „alte Kleister“ des Dichters erwähnt, was möglicherweise auf das Festhalten an überholten Formen der Dichtung und den Widerstand gegen neue, revolutionäre Ideen hinweist. Der Hinweis auf „Jupiter von Weimar“, eine Anspielung auf Goethe, unterstreicht die ideelle Verbindung zur Weimarer Klassik und zeigt den Dichter als jemand, der sich bewusst in traditionellen, beschränkten Formen bewegt, um die wahre Meisterschaft in der Dichtkunst zu bewahren. Das Gedicht endet mit einem ironischen Appell an die „Beschränktheit“, die als wahrer Ausdruck von Meisterschaft im poetischen Schaffen angesehen wird – eine kritische Reflexion auf die Dichterkunst und den Wert von Tradition und Form.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.