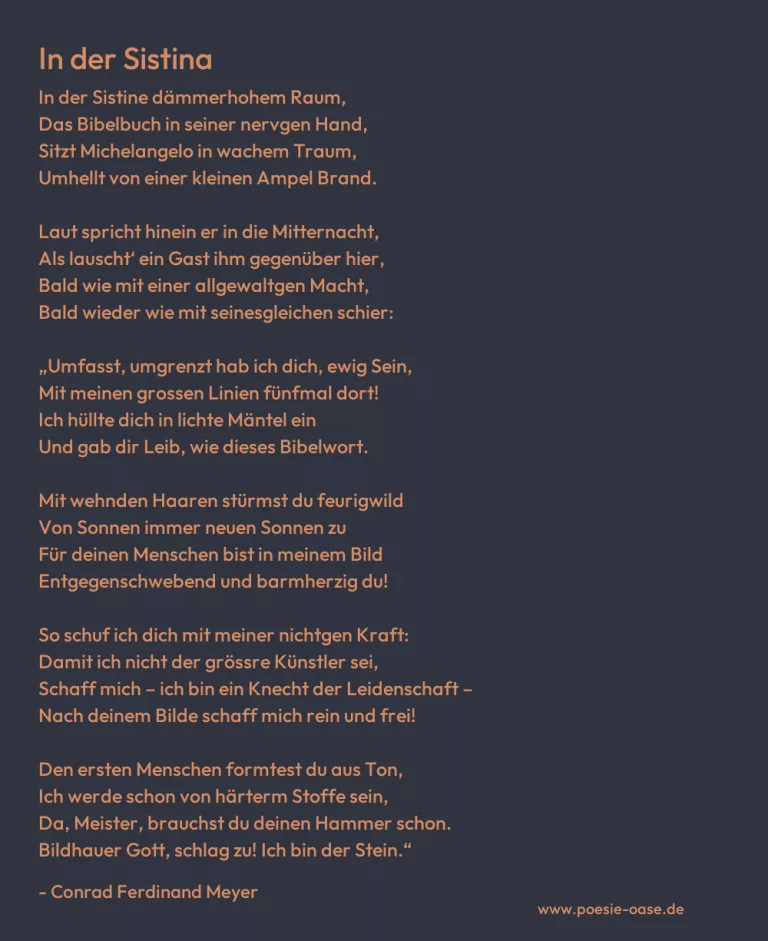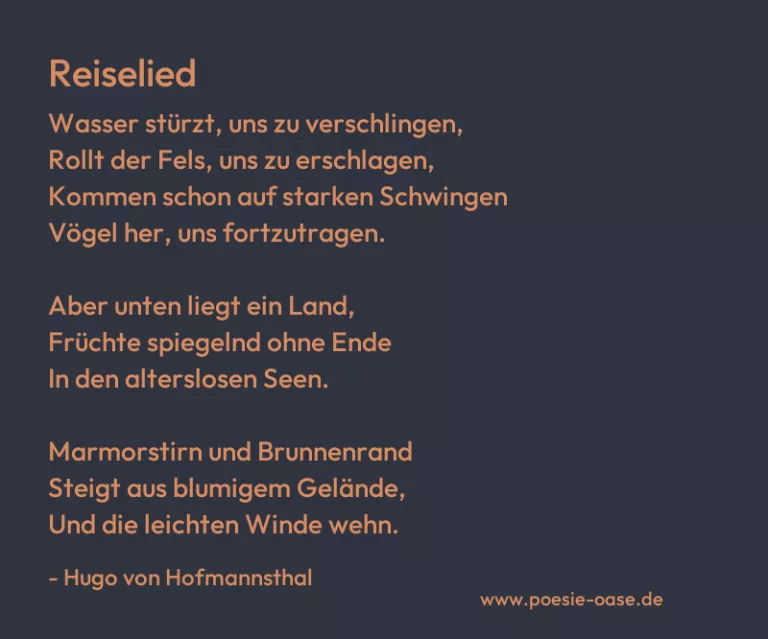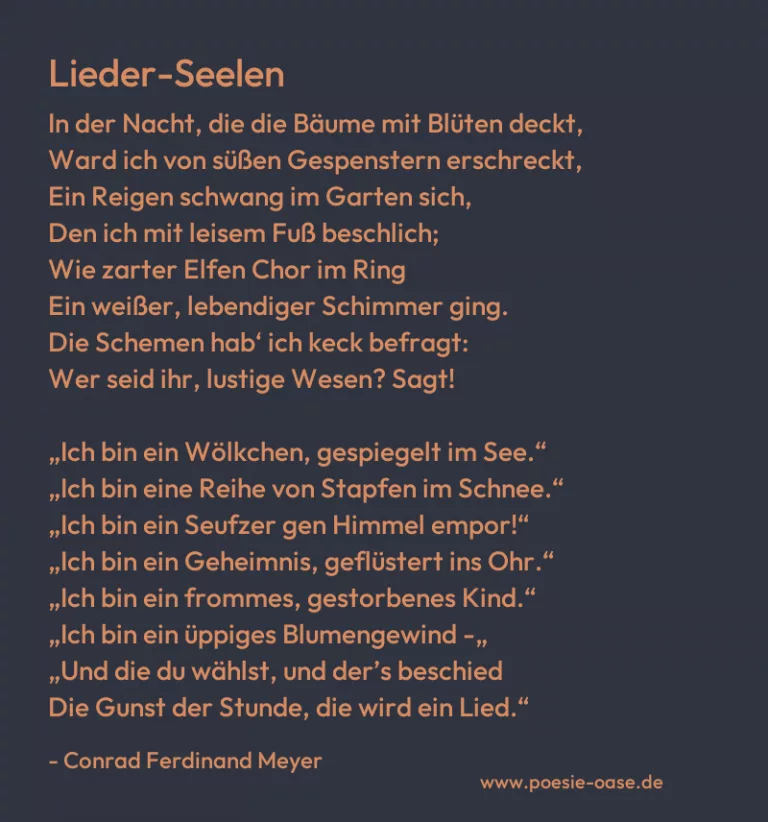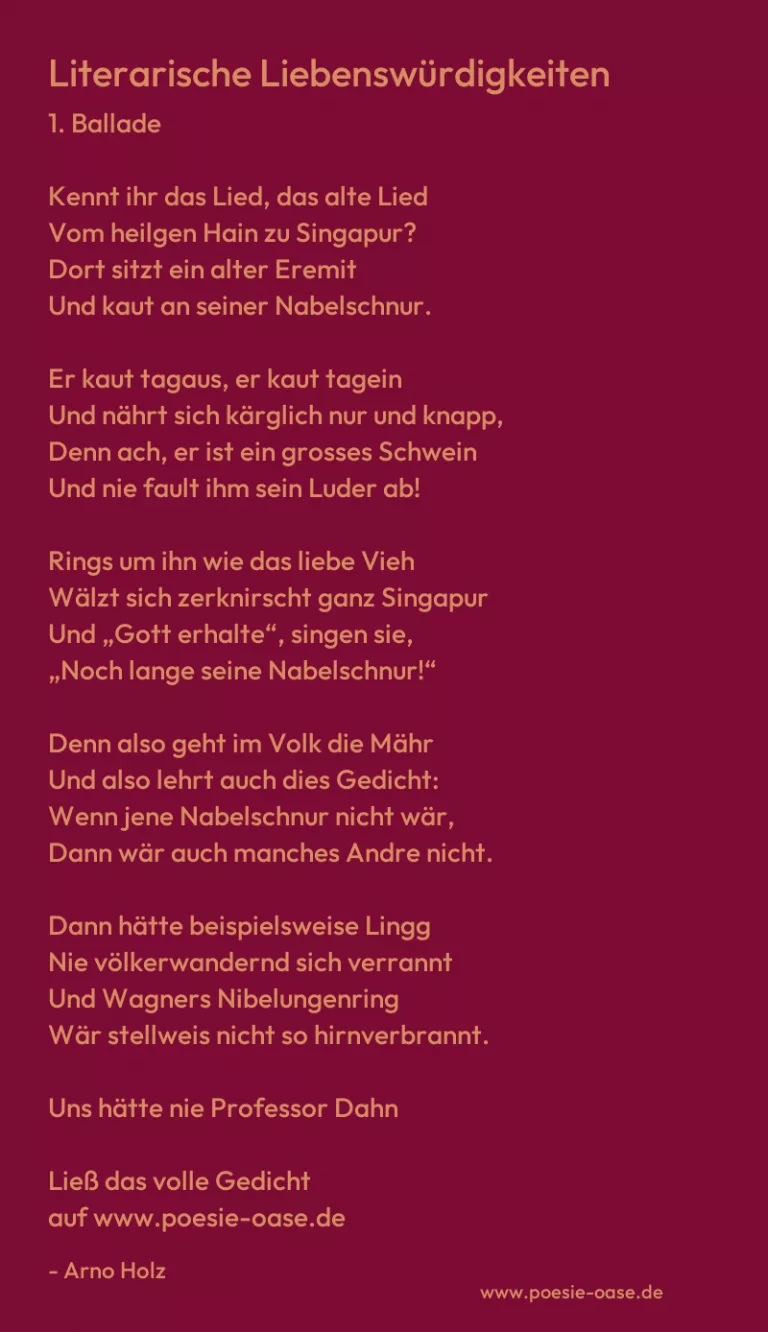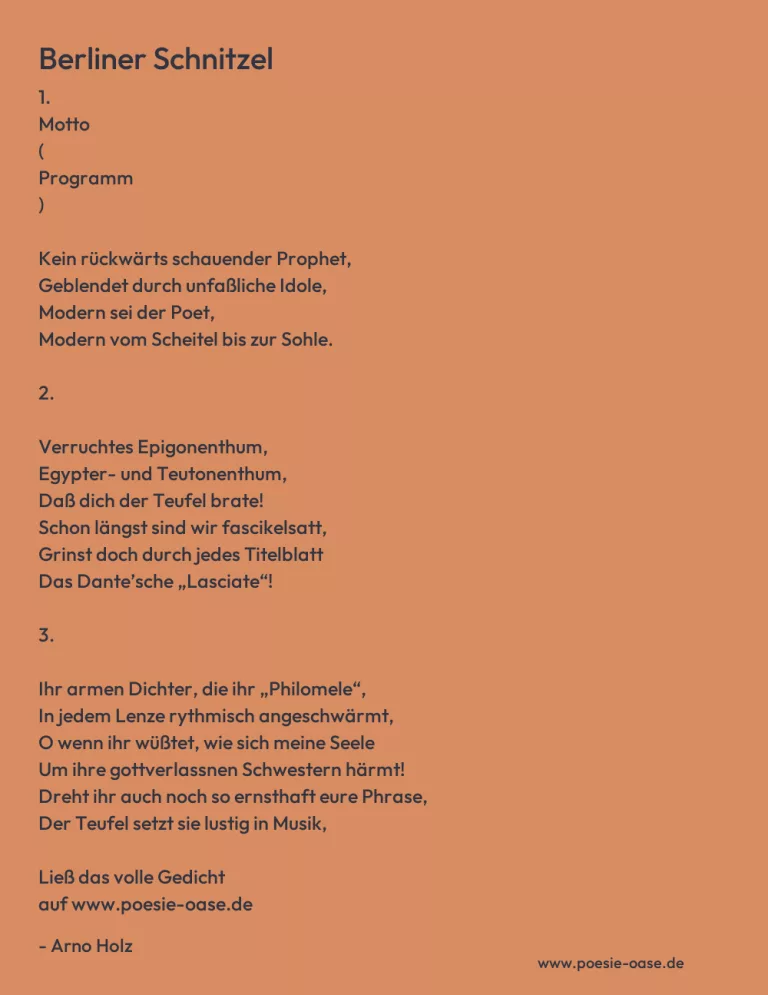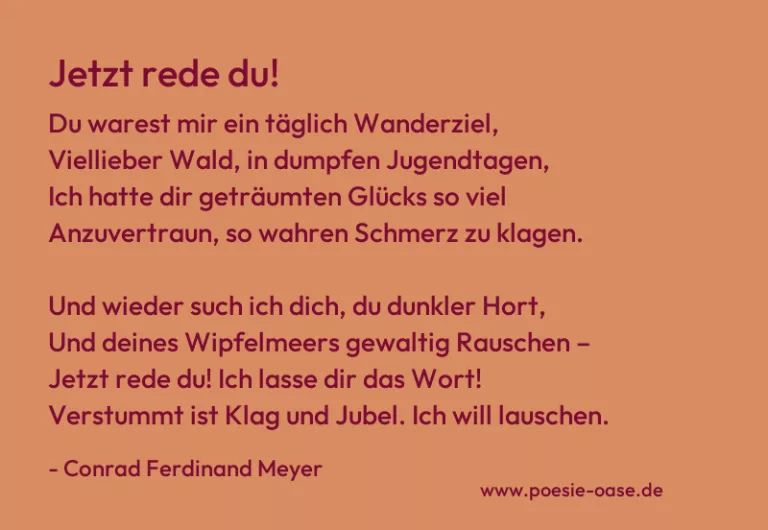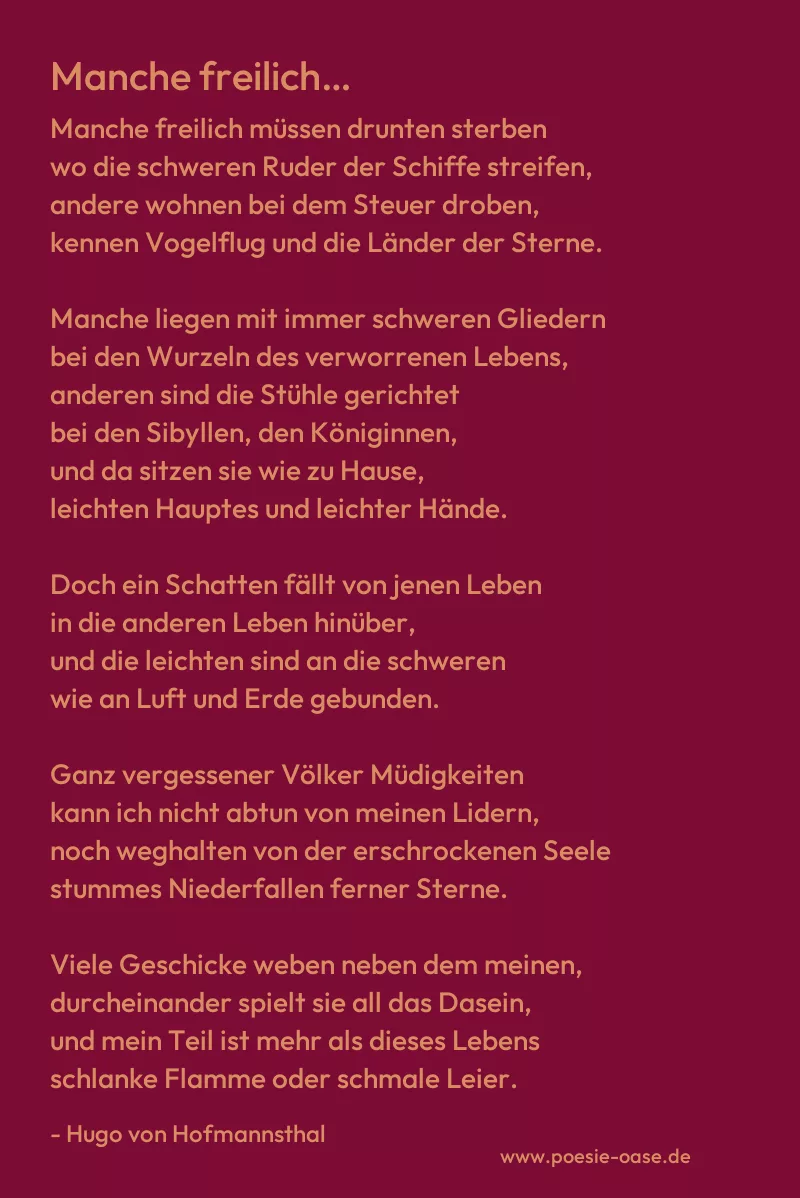Manche freilich…
Manche freilich müssen drunten sterben
wo die schweren Ruder der Schiffe streifen,
andere wohnen bei dem Steuer droben,
kennen Vogelflug und die Länder der Sterne.
Manche liegen mit immer schweren Gliedern
bei den Wurzeln des verworrenen Lebens,
anderen sind die Stühle gerichtet
bei den Sibyllen, den Königinnen,
und da sitzen sie wie zu Hause,
leichten Hauptes und leichter Hände.
Doch ein Schatten fällt von jenen Leben
in die anderen Leben hinüber,
und die leichten sind an die schweren
wie an Luft und Erde gebunden.
Ganz vergessener Völker Müdigkeiten
kann ich nicht abtun von meinen Lidern,
noch weghalten von der erschrockenen Seele
stummes Niederfallen ferner Sterne.
Viele Geschicke weben neben dem meinen,
durcheinander spielt sie all das Dasein,
und mein Teil ist mehr als dieses Lebens
schlanke Flamme oder schmale Leier.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
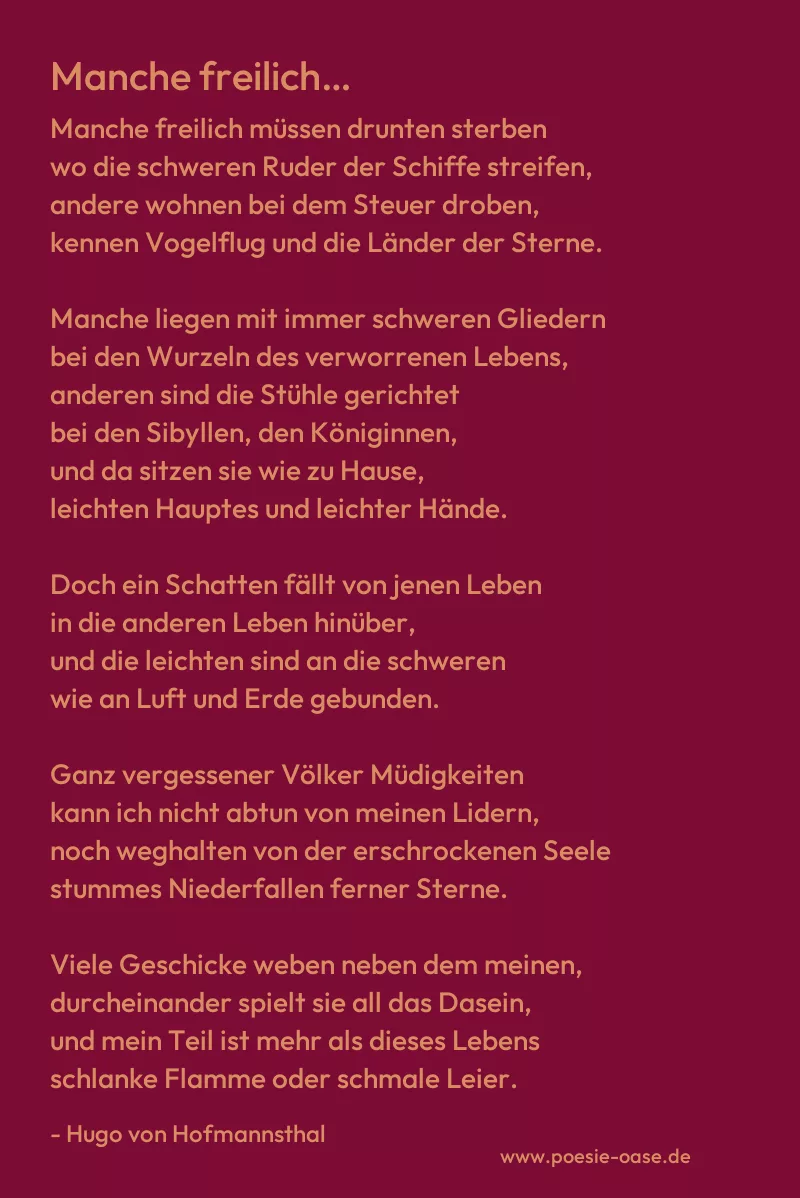
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Manche freilich…“ von Hugo von Hofmannsthal ist eine kontemplative Meditation über die Vielfalt menschlicher Existenzformen und das tiefe Ineinanderwirken von Schicksalen. In einem ruhigen, beinahe feierlichen Ton entfaltet das lyrische Ich eine Bildwelt, in der Gegensätze wie Schwere und Leichtigkeit, Oben und Unten, Erkenntnis und Erdverhaftung nicht voneinander getrennt sind, sondern in einer geheimnisvollen Verbundenheit stehen.
Die erste Strophe stellt zwei Menschentypen gegenüber: Die einen sterben „drunten“, im Bereich des Physischen und Mühevollen, wo die „schweren Ruder der Schiffe streifen“ – ein Sinnbild für das arbeitsreiche, vielleicht auch leidvolle Leben. Die anderen hingegen „wohnen bei dem Steuer droben“, sind also steuernde, schauende Wesen, die „Vogelflug“ und „die Länder der Sterne“ kennen – sie symbolisieren Erkenntnis, Geist, vielleicht auch Berufung oder Berufung zum Schönen und Erhabenen. Doch diese Zweiteilung ist nur scheinbar klar.
Die folgenden Verse beschreiben erneut die Trennung zwischen den „schweren Gliedern“ der einen, die mit dem „verworrenen Leben“ verwurzelt sind, und den anderen, die in der Nähe von „Sibyllen“ und „Königinnen“ leben – Bilder für Weisheit, Mysterium und Würde. Diese Auserwählten wirken leicht, gelöst, fast überirdisch. Doch auch sie bleiben nicht unberührt vom Leid der anderen.
Denn „ein Schatten fällt von jenen Leben / in die anderen Leben hinüber“ – hier zeigt sich Hofmannsthals tiefes Verständnis von der Durchdringung der Schicksale. Keine Existenz steht für sich. Selbst die Leichten sind „an die schweren / wie an Luft und Erde gebunden“. Das Leid, die Mühsal, selbst die Geschichte vergangener Völker, all das haftet noch dem feinsten Geist an. So wird das lyrische Ich von einer „ganz vergessener Völker Müdigkeit“ überschattet – eine poetische Formulierung für eine kollektive, fast mythische Melancholie, die sich nicht abschütteln lässt.
Im letzten Abschnitt weitet sich das Bild noch einmal: Das Dasein ist ein Gewebe von „vielen Geschicken“, die sich kreuzen und vermischen. Die eigene Existenz ist nicht isoliert, sondern eingebettet in ein größeres, geheimnisvolles Spiel. Die letzte Zeile betont diese Tiefendimension des Selbst: „mein Teil ist mehr als dieses Lebens / schlanke Flamme oder schmale Leier“. Das bedeutet: Das Ich ist nicht nur Ausdruck einer ästhetischen, flüchtigen Existenz (Flamme, Leier), sondern Teil eines umfassenden kosmischen Zusammenhangs.
„Manche freilich…“ ist ein nachdenkliches, zugleich hochpoetisches Gedicht, das von der unauflösbaren Verflechtung aller Daseinsformen erzählt. Hofmannsthal gibt hier seiner Überzeugung Ausdruck, dass das Leben nicht in klaren Kategorien zu fassen ist, sondern in einem geheimnisvollen, mitfühlenden Ganzen steht – getragen von Schicksal, Erinnerung und einer tiefen seelischen Resonanz.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.