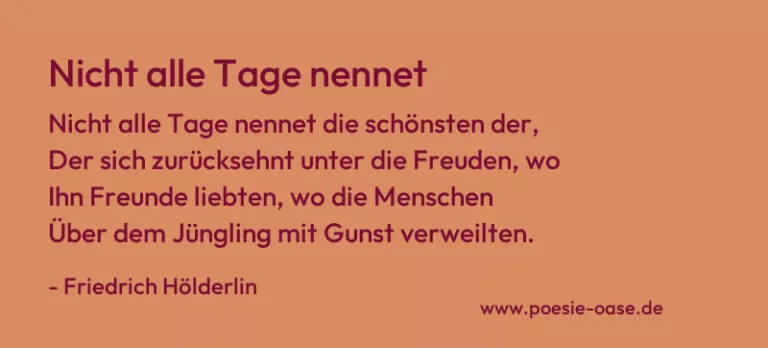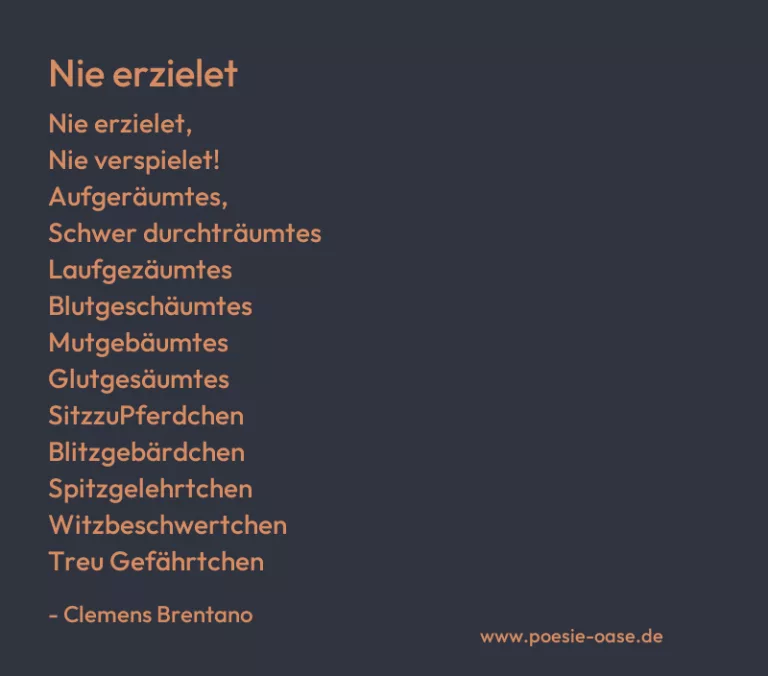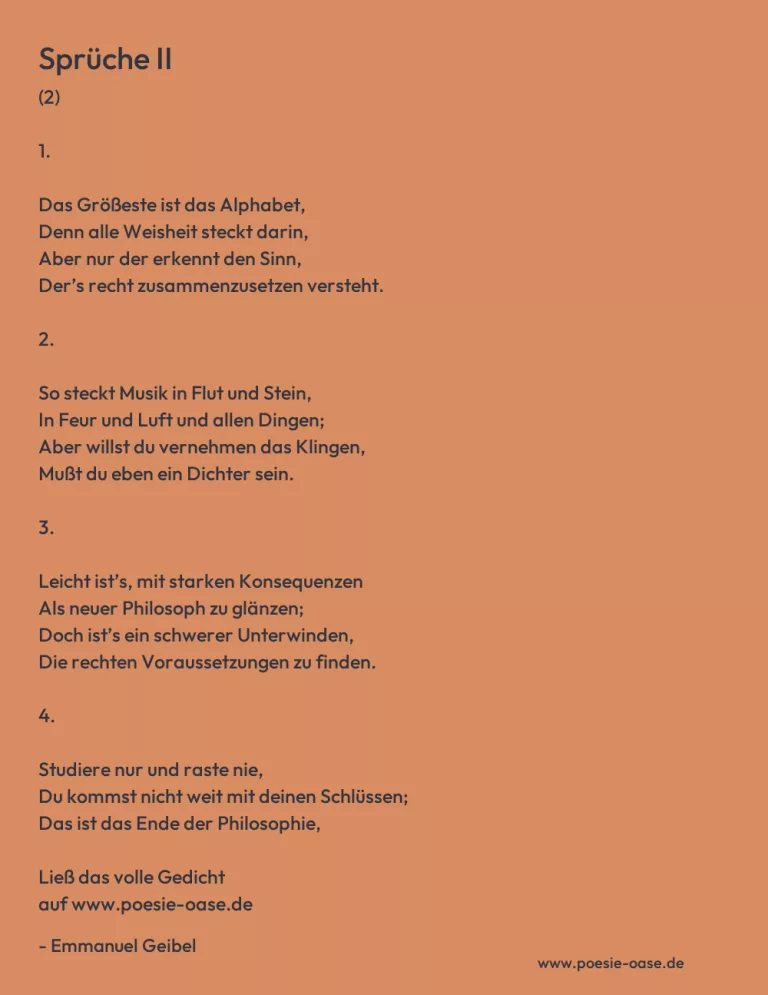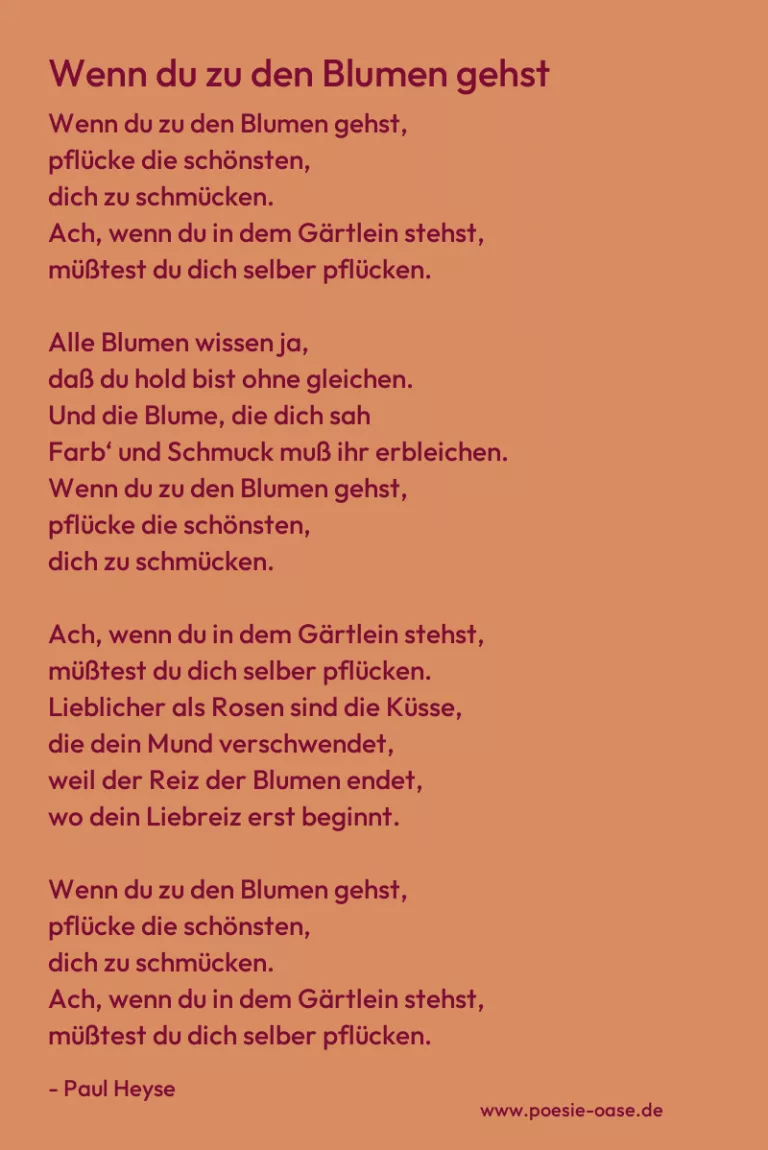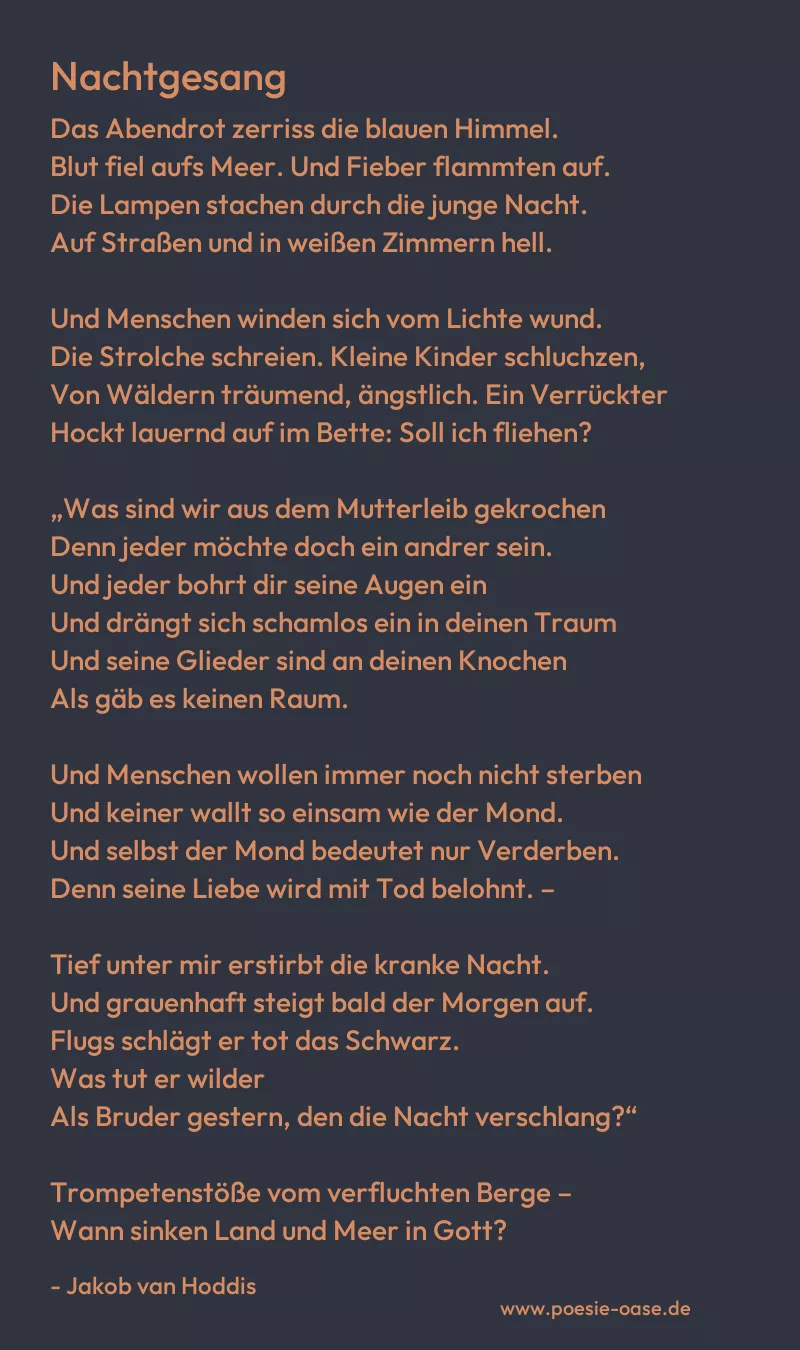Nachtgesang
Das Abendrot zerriss die blauen Himmel.
Blut fiel aufs Meer. Und Fieber flammten auf.
Die Lampen stachen durch die junge Nacht.
Auf Straßen und in weißen Zimmern hell.
Und Menschen winden sich vom Lichte wund.
Die Strolche schreien. Kleine Kinder schluchzen,
Von Wäldern träumend, ängstlich. Ein Verrückter
Hockt lauernd auf im Bette: Soll ich fliehen?
„Was sind wir aus dem Mutterleib gekrochen
Denn jeder möchte doch ein andrer sein.
Und jeder bohrt dir seine Augen ein
Und drängt sich schamlos ein in deinen Traum
Und seine Glieder sind an deinen Knochen
Als gäb es keinen Raum.
Und Menschen wollen immer noch nicht sterben
Und keiner wallt so einsam wie der Mond.
Und selbst der Mond bedeutet nur Verderben.
Denn seine Liebe wird mit Tod belohnt. –
Tief unter mir erstirbt die kranke Nacht.
Und grauenhaft steigt bald der Morgen auf.
Flugs schlägt er tot das Schwarz.
Was tut er wilder
Als Bruder gestern, den die Nacht verschlang?“
Trompetenstöße vom verfluchten Berge –
Wann sinken Land und Meer in Gott?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
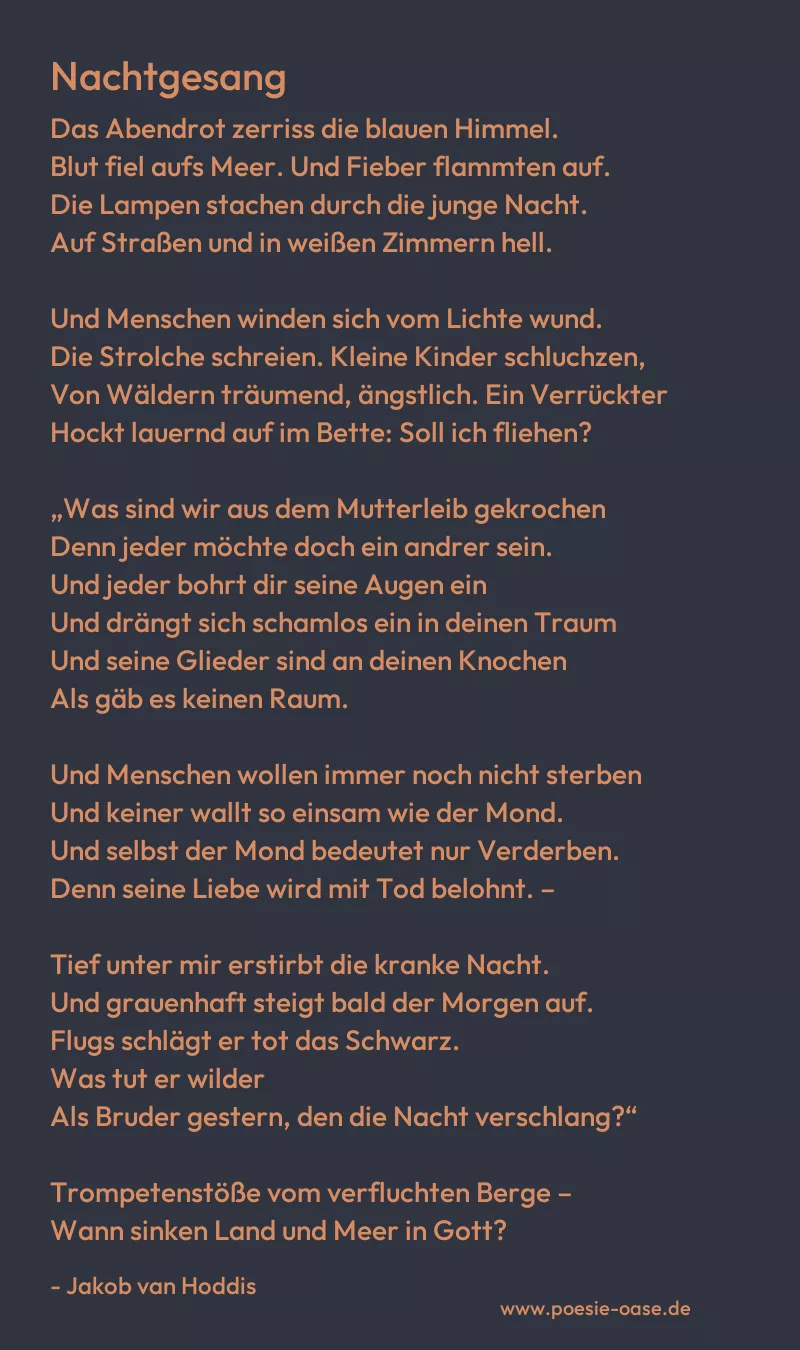
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Nachtgesang“ von Jakob van Hoddis ist von einer düsteren, beinahe apokalyptischen Stimmung durchzogen und beschäftigt sich mit den existenziellen Ängsten und der Unausweichlichkeit des Lebens und Todes. Der Beginn mit dem „Abendrot“, das die „blauen Himmel“ zerriß, stellt bereits eine Szene des Übergangs dar – das Ende eines Tages, das den Beginn der Nacht und die Dunkelheit ankündigt. Der „Blut“ auf dem Meer und das „Fieber“, das „flammt“, erzeugen ein Bild von Gewalt, Zerstörung und innerer Unruhe, das durch das Aufleuchten der Lampen in der Nacht noch verstärkt wird. Diese Lichtquellen scheinen nicht zu erhellen, sondern eher wie ein nächtliches Memento des unausweichlichen Schreckens, der über die Welt hereinbricht.
Die Darstellung der Menschen, die „sich vom Lichte wund winden“, spricht von einer tiefen, inneren Qual und einer Entfremdung vom Leben. Die „Strolche“ und „kleine Kinder“, die „schluchzen“, stehen in starkem Kontrast zur Traumwelt der „Wälder“, die mit Angst und Unsicherheit durchzogen ist. Der „Verrückte“, der im Bett „lauernd“ fragt, ob er fliehen soll, vermittelt das Gefühl einer lähmenden, psychischen Zerrüttung, in der der Mensch sich nicht nur vor äußeren Gefahren, sondern auch vor den eigenen Ängsten und der unaufhaltsamen Dunkelheit fürchtet.
Im nächsten Abschnitt wird die menschliche Existenz in eine zerrissene, unbefriedigte Dimension gerückt. Die Zeilen „Was sind wir aus dem Mutterleib gekrochen / Denn jeder möchte doch ein andrer sein“ sprechen von einer grundlegenden Unzufriedenheit mit dem eigenen Dasein, von der Suche nach einer anderen Identität. Es scheint eine Auseinandersetzung mit der Unfähigkeit des Menschen zu sein, sich selbst zu akzeptieren, was durch die Bilder der Gewalt – „bohrt dir seine Augen ein“ – und der Unfreiheit, die durch den Körper eines anderen auferlegt wird, verdeutlicht wird. Das Eindringen des Anderen in den eigenen Traum, die Verletzung des eigenen Raumes, lässt sich als Symbol für das Gefühl der Entfremdung und des Verlustes des eigenen Ichs deuten.
Der Verweis auf den Mond als „wilder Bruder“, der „gestern von der Nacht verschlungen“ wurde, verstärkt die dunkle Symbolik des Gedichts. Der Mond wird als ein Sinnbild für Einsamkeit und Verderben dargestellt, da seine „Liebe“ nur mit „Tod“ belohnt wird. Der Mond, der häufig mit einem romantischen oder geheimnisvollen Licht in Verbindung gebracht wird, verliert hier seine positive Bedeutung und wird zum Symbol für die Unausweichlichkeit des Todes und der Zerstörung.
Das Gedicht endet mit einer apokalyptischen Vision, die durch „Trompetenstöße“ und die Vorstellung, dass „Land und Meer in Gott sinken“, noch verstärkt wird. Diese Passage verweist auf biblische Motive, wie das Ende der Welt und das letzte Gericht, und stellt die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem unausweichlichen Ende des Daseins. Es ist ein Gedicht, das die Dunkelheit des menschlichen Daseins, die innere Zerrissenheit und die existenzielle Angst thematisiert und die Vergänglichkeit des Lebens als unausweichliche Wahrheit entlarvt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.