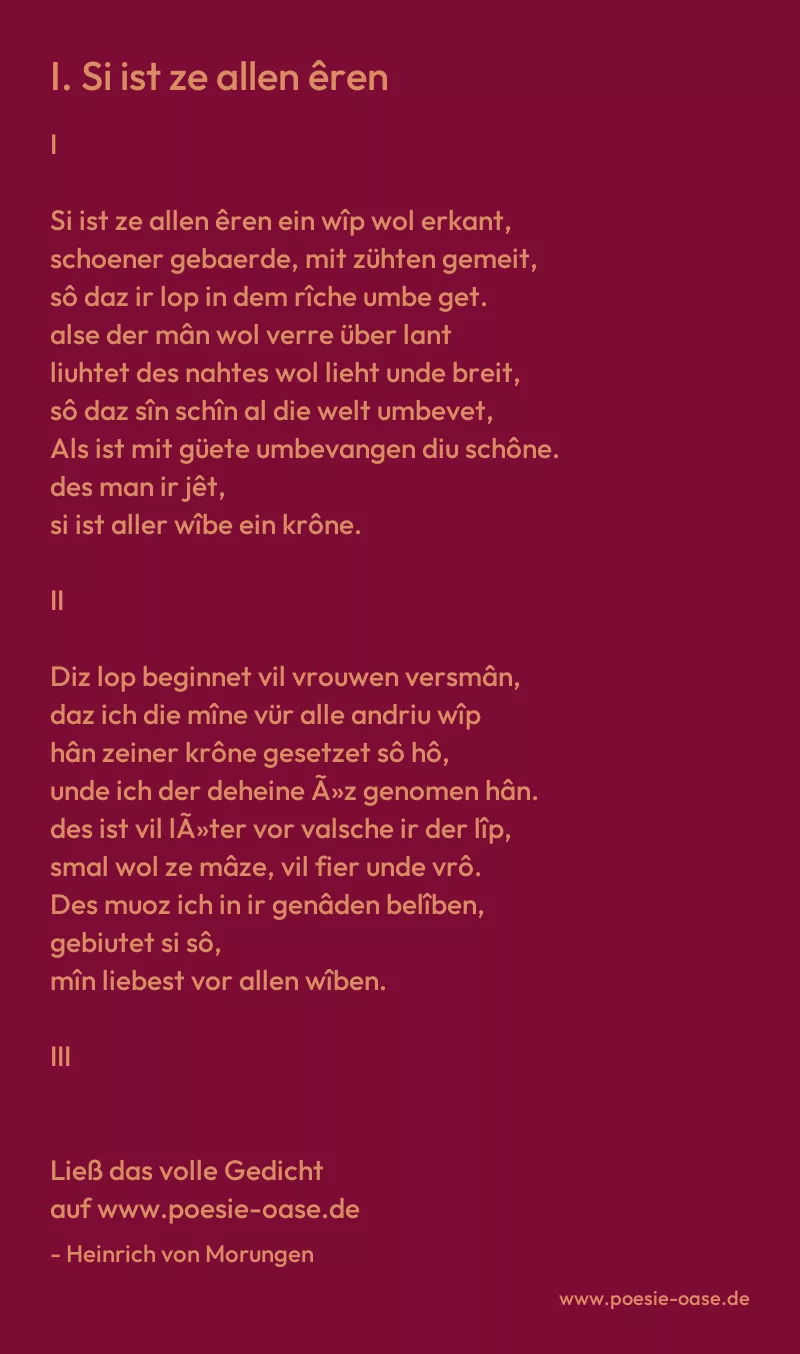I. Si ist ze allen êren
I
Si ist ze allen êren ein wîp wol erkant,
schoener gebaerde, mit zühten gemeit,
sô daz ir lop in dem rîche umbe get.
alse der mân wol verre über lant
liuhtet des nahtes wol lieht unde breit,
sô daz sîn schîn al die welt umbevet,
Als ist mit güete umbevangen diu schône.
des man ir jêt,
si ist aller wîbe ein krône.
II
Diz lop beginnet vil vrouwen versmân,
daz ich die mîne vür alle andriu wîp
hân zeiner krône gesetzet sô hô,
unde ich der deheine ûz genomen hân.
des ist vil lûter vor valsche ir der lîp,
smal wol ze mâze, vil fier unde vrô.
Des muoz ich in ir genâden belîben,
gebiutet si sô,
mîn liebest vor allen wîben.
III
Got lâze sî mir vil lange gesunt,
die ich an wîplîcher staete noch ie vant,
sît si mîn lîp ze einer vrowen erkôs.
wol ir vil süezer – vil rôt ist ir der munt,
ir zene wîze ebene – verre bekant,
durch die ich gar alle unstaete verkôs,
Dô man si lobte als reine unde wîse,
senfte unde lôs;
dar umbe ich si noch prîse.
IV
Ir tugent reine ist der sunnen gelîch,
diu trüebiu wolken tuot liehte gevar,
swenne in dem meien ir schîn ist sô klâr.
des wirde ich staeter vröide vil rîch,
daz überliuhtet ir lop alsô gar
wîp unde vrowen die besten vür wâr,
Die man benennet in tiuschem lande.
verre unde nâr
sô ist si ez, diu baz erkande.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
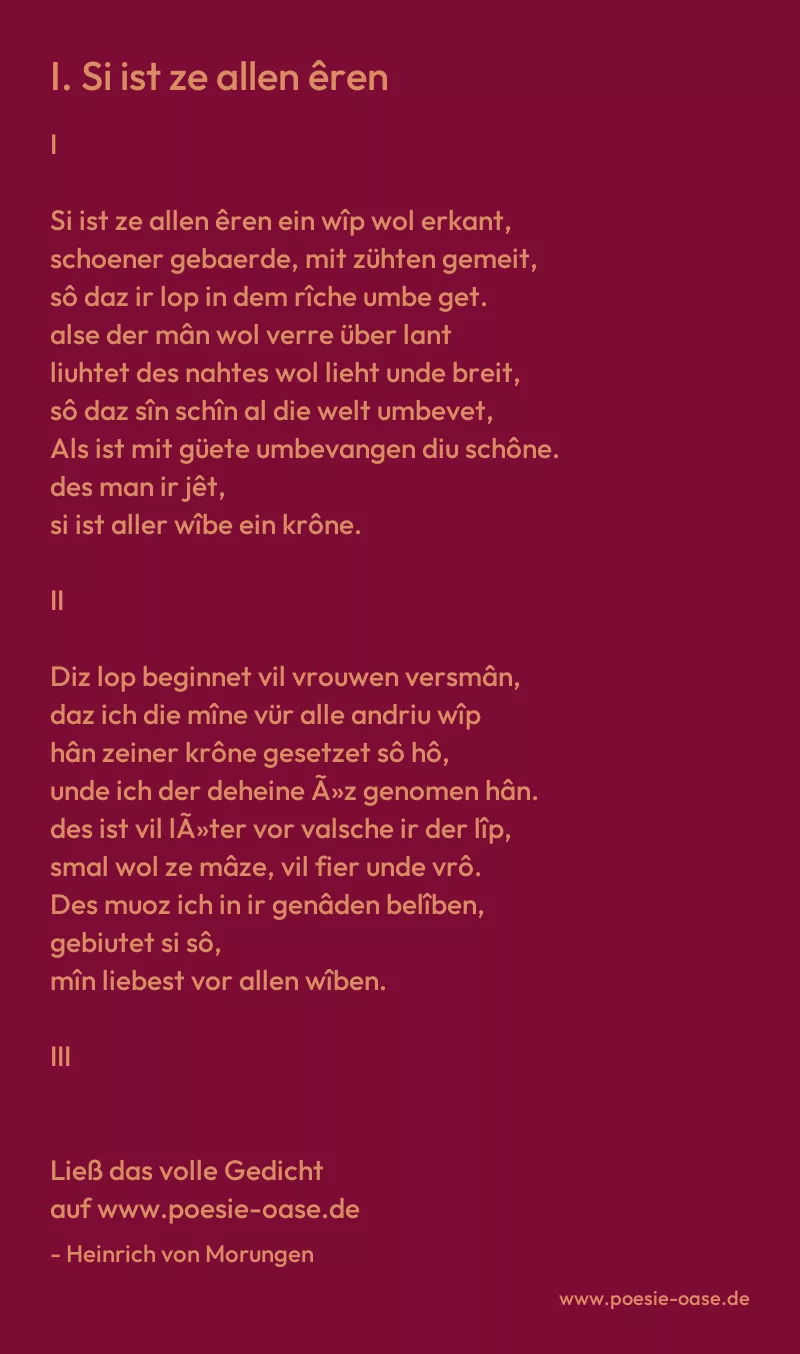
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „I. Si ist ze allen êren“ von Heinrich von Morungen ist eine Minnelied-Hymne auf die geliebte Frau. Es handelt sich um eine detaillierte und überschwängliche Lobpreisung ihrer Schönheit, ihrer Tugenden und ihrer Einzigartigkeit. Das Gedicht ist in vier Strophen gegliedert, die jeweils verschiedene Aspekte dieser Lobpreisung hervorheben und so ein umfassendes Bild der Idealgestalt der Dame entwerfen.
In der ersten Strophe wird die Dame als eine Frau von höchstem Ansehen und Tugend beschrieben. Sie wird als „wol erkant“ (wohlbekannt) und von „schoener gebaerde, mit zühten gemeit“ (schöner Gestalt, mit Anstand geschmückt) bezeichnet. Ihr Lob verbreitet sich im ganzen Land, ähnlich wie der Mond, der die Nacht erhellt. Diese Metapher unterstreicht ihre Strahlkraft und ihren Einfluss. Das Gedicht hebt auch ihre „güete“ (Güte) hervor, die sie zu einer „krône“ (Krone) aller Frauen macht.
Die zweite Strophe setzt die Lobpreisung fort, indem der Dichter seine Wahl seiner Geliebten begründet. Er betont ihre Reinheit, ihre Anmut und ihre Fröhlichkeit. Der Dichter erklärt, dass er sie allen anderen Frauen vorzieht. Ihre äußere Erscheinung wird als „smal wol ze mâze, vil fier unde vrô“ (fein und wohlgestaltet, stolz und froh) beschrieben, was ihre vollkommene physische Erscheinung hervorhebt. Der Dichter bekennt sich zu seiner Abhängigkeit von ihren „genâden“ (Gnade) und betont so die zentrale Rolle, die sie in seinem Leben spielt.
Die dritte Strophe widmet sich der Bitte um Gesundheit für die Geliebte und lobt ihre „staete“ (Beständigkeit). Ihre Schönheit wird durch den Vergleich mit einem „vil süezer – vil rôt ist ir der munt, ir zene wîze ebene“ (sehr süßen – sehr rot ist ihr Mund, ihre Zähne weiß und eben) beschrieben, was ihre Sinnlichkeit betont. Die Erwähnung ihres „süezer“ (süß) Mundes und der weißen Zähne verstärkt das Bild der perfekten Schönheit. Der Dichter bekräftigt seine Entscheidung für sie und erklärt, dass er seinetwegen allen „unstaete“ (Unbeständigkeit) abgeschworen hat.
Die letzte Strophe vergleicht ihre Tugenden mit der Sonne, die trübe Wolken in Helligkeit verwandelt. Der Dichter freut sich über diese „vröide“ (Freude) und lobt ihre „lop“ (Lob) als überaus wertvoll. Es werden die besten Frauen in Deutschland als „vür wâr“ (wahrhaft) dargestellt. Dies verdeutlicht die universelle Anerkennung ihrer Vorzüglichkeit. Das Gedicht schließt mit dem Bekenntnis, dass sie diejenige ist, die am besten bekannt ist und die höchste Anerkennung verdient.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.