Mein Jettchen, mein Herzchen, mein Liebes, mein
Täubchen, mein Leben, mein liebes süßes Leben,
mein Lebenslicht, mein Alles, mein Hab und Gut,
meine Schlösser, Äcker, Wiesen und Weinberge, o
Sonne meines Lebens, Sonne, Mond und Sterne, Him-
mel und Erde, meine Vergangenheit und Zukunft,
meine Braut, mein Mädchen, meine liebe Freundin,
mein Innerstes, mein Herzblut, meine Eingeweide,
mein Augenstern, o, Liebste, wie nenn ich Dich?
Mein Goldkind, meine Perle, mein Edelstein, meine
Krone, meine Königin und Kaiserin. Du lieber Lieb-
ling, meines Herzens, mein Höchstes und Teuerstes,
mein Alles und Jedes, mein Weib, meine Hochzeit,
die Taufe meiner Kinder, mein Trauerspiel, mein
Nachruhm. Ach Du bist mein zweites besseres Ich,
meine Tugenden, meine Verdienste, meine Hoffnung,
die Vergebung meiner Sünden, meine Zukunft und
Seligkeit, o, Himmelstöchterchen, mein Gotteskind,
meine Fürsprecherin und Fürbitterin, mein Schutzen-
gel, mein Cherubim und Seraph, wie lieb ich Dich! –
Für Adolfine Henriette Vogel
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
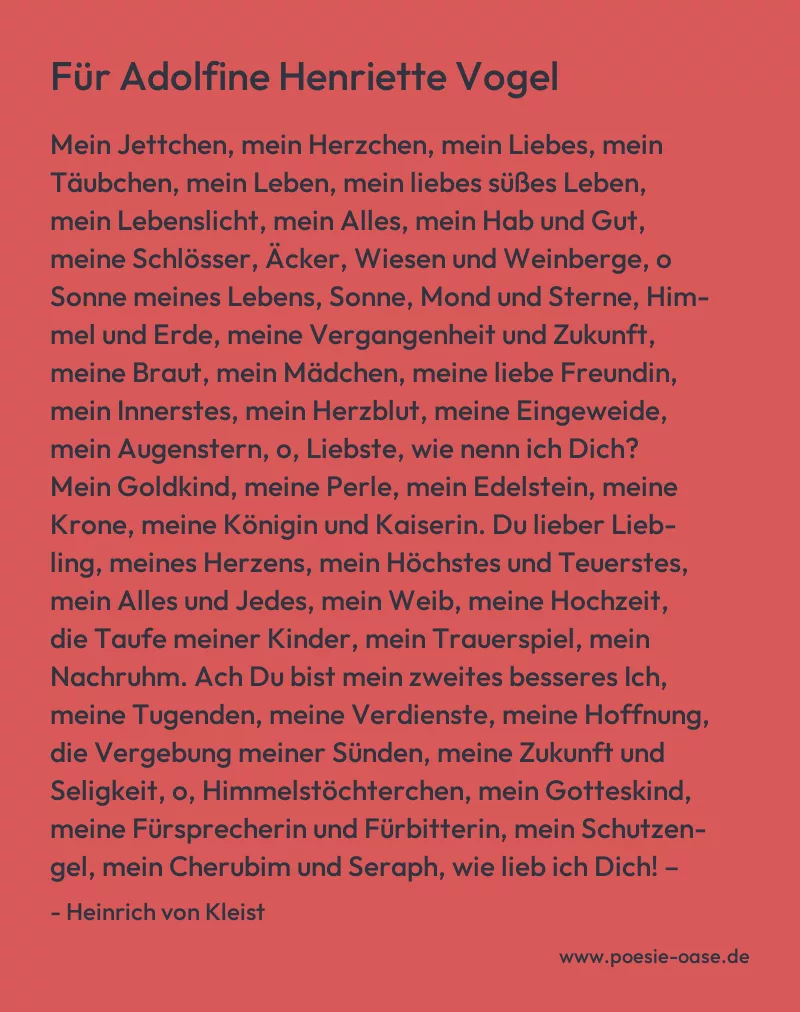
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Für Adolfine Henriette Vogel“ von Heinrich von Kleist ist eine überschwängliche Liebeserklärung, die sich in einer Fülle von Adjektiven und Metaphern ergießt. Es ist ein wahres Feuerwerk an Zuneigung, das die Geliebte mit einer kaum fassbaren Anzahl von Begriffen und Bezeichnungen überhäuft. Die Sprache ist unmittelbar und expressiv, wobei Kleist sich nicht scheut, sowohl himmlische als auch weltliche Attribute zu verwenden, um die Bedeutung von Adolfine in seinem Leben zu beschreiben.
Die verwendete Rhetorik ist geprägt von einer Übertreibung, die ins fast Spielerische gleitet. Kleist steigert sich in seinem Lobgesang, indem er Adolfine zunächst mit vertrauten, liebevollen Kosenamen wie „Jettchen“, „Herzchen“ und „Täubchen“ anspricht und sie dann in einen Kosmos von Bedeutung einordnet. Sie ist sein „Leben“, seine „Sonne“, sein „Himmel“ und seine „Zukunft“. Diese allumfassende Sichtweise zeigt, wie tief die Gefühlswelt des Dichters durch die Liebe zu Adolfine beeinflusst wird. Die Gleichsetzung von „Braut“, „Mädchen“ und „Freundin“ unterstreicht dabei die unterschiedlichen Ebenen der Beziehung.
Bemerkenswert ist die Vermischung von weltlichen und religiösen Elementen. Adolfine ist nicht nur „Goldkind“ und „Krone“, sondern auch „Himmelstöchterchen“, „Gotteskind“ und „Schutzengel“. Diese Vermischung von Diesseits und Jenseits deutet auf die fast göttliche Verehrung, die Kleist seiner Geliebten entgegenbringt. Sie wird zur Hoffnung, zur Vergebung und zur Seligkeit. Dieses Zusammenspiel von Irdischem und Überirdischem verleiht dem Gedicht eine besondere Intensität und unterstreicht die unendliche Wertschätzung, die Kleist für Adolfine empfindet.
Die Struktur des Gedichts ist geprägt von der Aufzählung und der Anreihung von Attributen, was den Eindruck von unerschöpflicher Liebe und Bewunderung verstärkt. Der lange, fast atemlose Satzbau spiegelt die überwältigende Emotion, die Kleist in diesem Moment empfindet. Das Gedicht ist weniger eine Analyse der Liebe, sondern vielmehr ein Akt der Hingabe und des Ausdrucks von tiefster Zuneigung. Es ist ein Zeugnis der Leidenschaft und der grenzenlosen Verehrung, die Kleist für Adolfine empfand.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
