Zweierlei ist das Geschlecht der Fraun; vielfältig ersprießlich
Jedem, daß er sie trennt: Dichtern vor allen. Merkt auf!
Ad Vocem
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
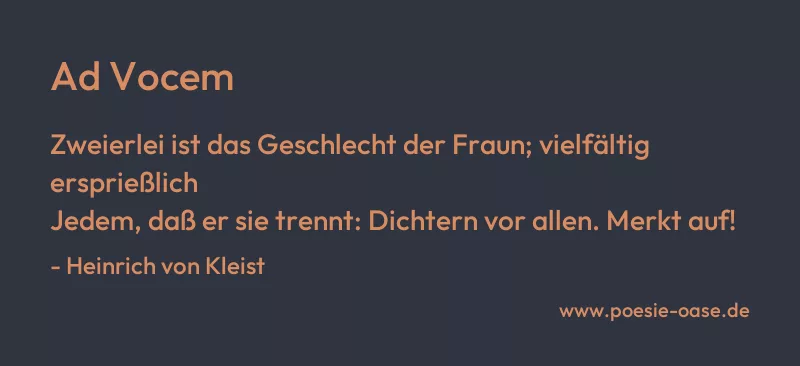
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ad Vocem“ von Heinrich von Kleist ist ein kurzes, prägnantes Werk, das die Beziehung zwischen Frauen und Dichtern untersucht. Die knappe Form und der direkte Stil sind typisch für Kleist, der oft in seinen Werken wesentliche Fragen auf den Punkt bringt. Die ersten Zeilen etablieren eine klare Dichotomie: „Zweierlei ist das Geschlecht der Fraun.“ Dies deutet auf eine Dualität hin, eine Aufteilung in verschiedene Kategorien oder Funktionen, die für das Verständnis des Themas entscheidend ist.
Die zweite Zeile führt die Bedeutung dieser Dichotomie für die Dichter ein: „vielfältig ersprießlich / Jedem, daß er sie trennt: Dichtern vor allen.“ Hier wird deutlich, dass die Unterscheidung und Trennung der Frauen für Dichter von besonderem Nutzen ist. Kleist impliziert, dass die Fähigkeit, Frauen in unterschiedliche Kategorien einzuteilen oder ihre verschiedenen Facetten zu erkennen, eine Quelle der Inspiration und des kreativen Potenzials für Dichter ist. Die Formulierung „Dichtern vor allen“ betont die Exklusivität dieser Beziehung.
Die Implikationen sind vielfältig. Einerseits könnte Kleist darauf anspielen, dass Dichter von der Vielfalt der weiblichen Charaktere und Erfahrungen profitieren, um ihre Werke zu gestalten. Unterschiedliche Arten von Frauen, unterschiedliche Erfahrungen, können als Inspiration für Figuren, Konflikte und Themen dienen. Andererseits könnte die Trennung auch als eine Art der Objektivierung interpretiert werden, bei der Frauen auf ihre verschiedenen „Funktionen“ oder Eigenschaften reduziert werden, um sie für die poetische Verarbeitung zugänglich zu machen.
Die abschließende Aufforderung „Merkt auf!“ dient als direkter Appell an den Leser. Sie unterstreicht die Bedeutung der vorhergehenden Aussage und lädt den Leser ein, über die komplexen Beziehungen zwischen Geschlecht, Kreativität und der Rolle des Dichters nachzudenken. Kleist fordert uns auf, die Nuancen und Implikationen seiner Worte zu erfassen, und zwingt uns, die zugrundeliegenden Annahmen und ethischen Fragen, die in diesem kurzen Gedicht aufgeworfen werden, zu hinterfragen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
