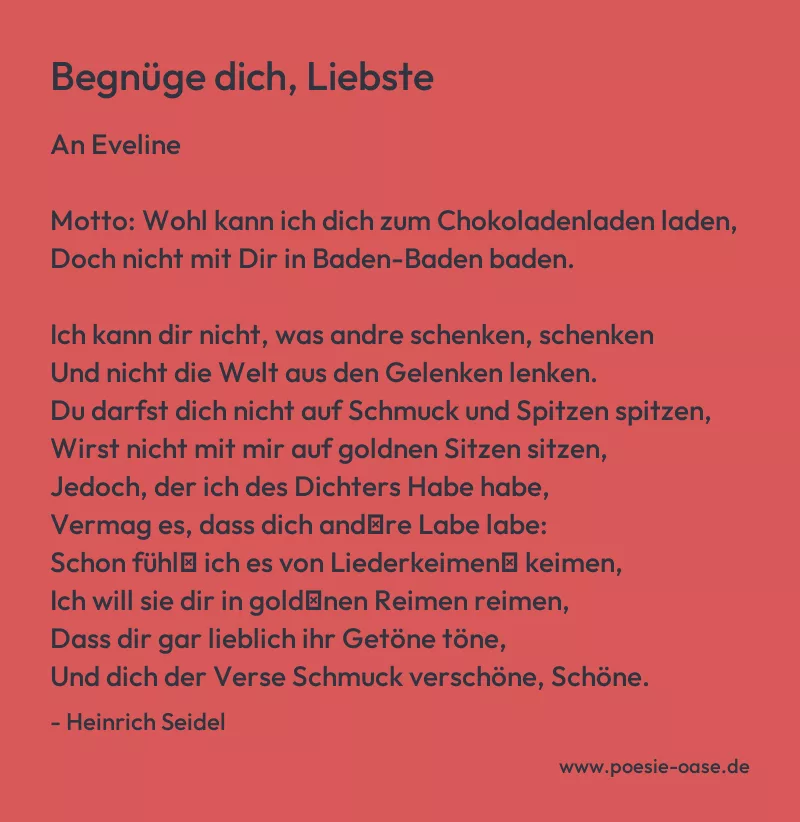Begnüge dich, Liebste
An Eveline
Motto: Wohl kann ich dich zum Chokoladenladen laden,
Doch nicht mit Dir in Baden-Baden baden.
Ich kann dir nicht, was andre schenken, schenken
Und nicht die Welt aus den Gelenken lenken.
Du darfst dich nicht auf Schmuck und Spitzen spitzen,
Wirst nicht mit mir auf goldnen Sitzen sitzen,
Jedoch, der ich des Dichters Habe habe,
Vermag es, dass dich and′re Labe labe:
Schon fühl′ ich es von Liederkeimen′ keimen,
Ich will sie dir in gold′nen Reimen reimen,
Dass dir gar lieblich ihr Getöne töne,
Und dich der Verse Schmuck verschöne, Schöne.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
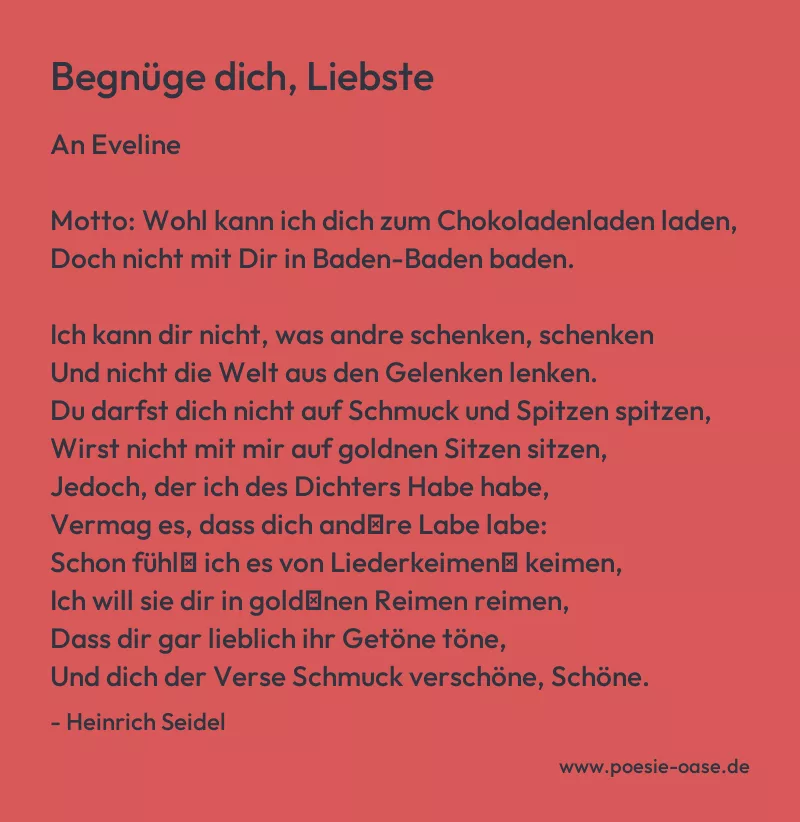
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Begnüge dich, Liebste“ von Heinrich Seidel ist eine Liebeserklärung, die sich durch Bescheidenheit und die Betonung der Macht der Poesie auszeichnet. Es wird im Kontext einer scheinbar unerfüllbaren Liebe verfasst, in der der Dichter seine Geliebte Eveline nicht mit materiellen Gütern oder luxuriösen Erlebnissen verwöhnen kann. Das Motto, das auf das Nicht-Erfüllen von Wünschen anspielt, verdeutlicht bereits die Ausgangssituation, in der das lyrische Ich seine Limitationen kennt und artikuliert.
Die zentralen Verse des Gedichts offenbaren die Begrenzungen des Dichters: Er kann seiner Geliebten keine materielle Fülle, keinen Luxus oder außergewöhnliche Erlebnisse bieten. Der Verzicht auf materielle Reichtümer wie Schmuck und goldene Sitze zeigt eine bewusste Abkehr von oberflächlichen Werten. Stattdessen konzentriert sich das lyrische Ich auf seine Fähigkeit, ihr durch seine Poesie Freude zu bereiten. Er verspricht ihr, seine Dichtung in goldenen Reimen zu verfassen, sodass ihre Worte lieblich klingen und ihr von dem Glanz seiner Verse verschönert werden möge.
Die Stärke des Gedichts liegt in der Umdeutung der scheinbaren Unzulänglichkeit in eine Quelle der Hingabe und des Trostes. Durch die Verwendung des Wortes „Jedoch“ erfolgt eine wichtige Wendung, die von der Unfähigkeit des Dichters zur Fähigkeit der Poesie überleitet. Die Hingabe an die Worte wird zur neuen Quelle der Erfüllung. Er versucht, seine Liebe durch die Kunst zu befriedigen, indem er sein Gefühl der Zuneigung und Wertschätzung in Worte fasst. Die Reimform und die Verwendung von Wortspielen (z.B. „keimen“ und „reimen“) unterstreichen die spielerische Natur der Poesie.
Insgesamt ist das Gedicht ein Bekenntnis zur Kraft der Poesie als Mittel der Liebe und Wertschätzung. Es bezeugt die Idee, dass wahre Zuneigung nicht von materiellen Dingen abhängt, sondern in den Emotionen und dem Ausdruck des Künstlers liegt. Die Schönheit der Verse, die Zuneigung, die aus ihnen spricht, und die Fähigkeit, Trost zu spenden, werden so zu einem Wert, der die Abwesenheit des Materiellen ausgleichen kann. Das Gedicht ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Poesie zu einem Trost und einer Form der Liebe werden kann, die über materielle Grenzen hinausgeht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.