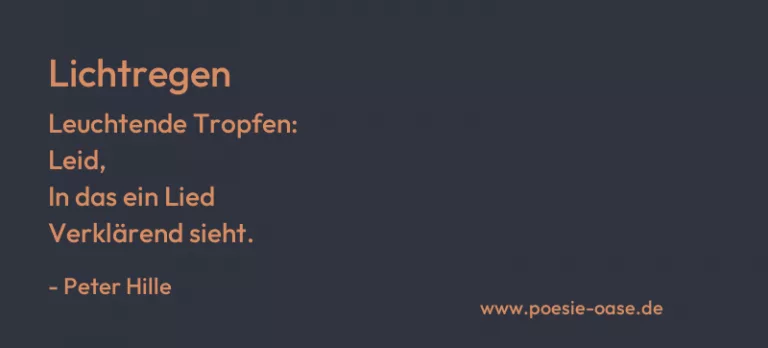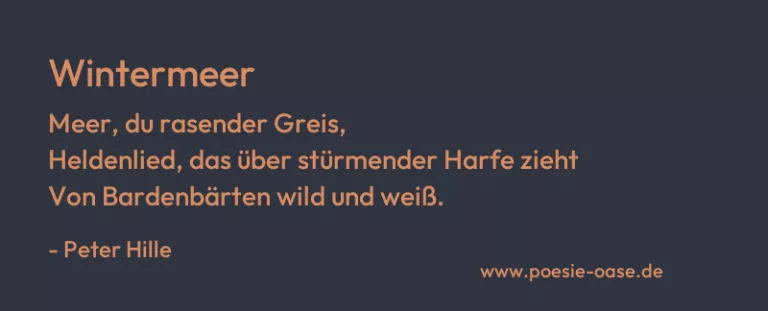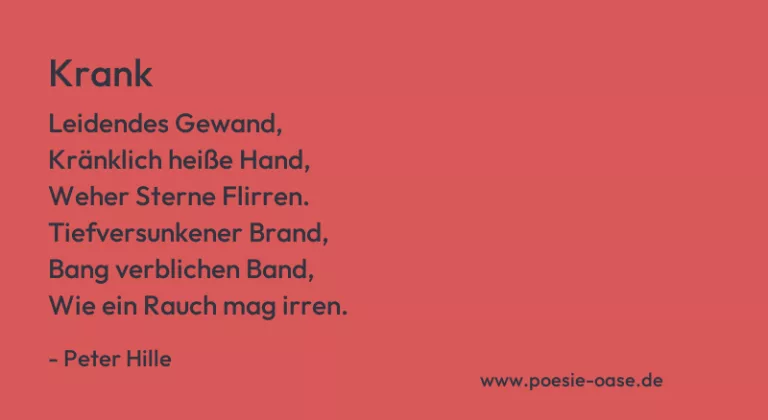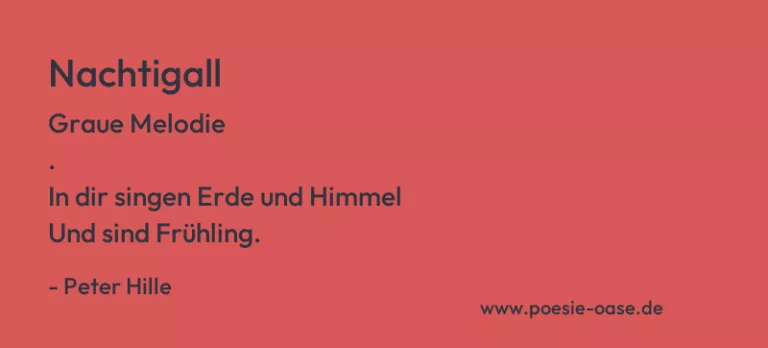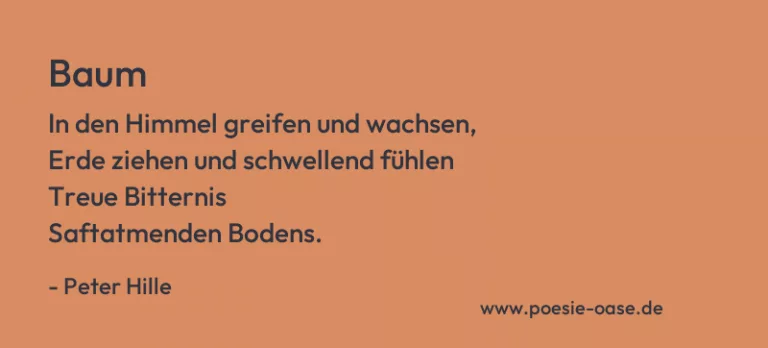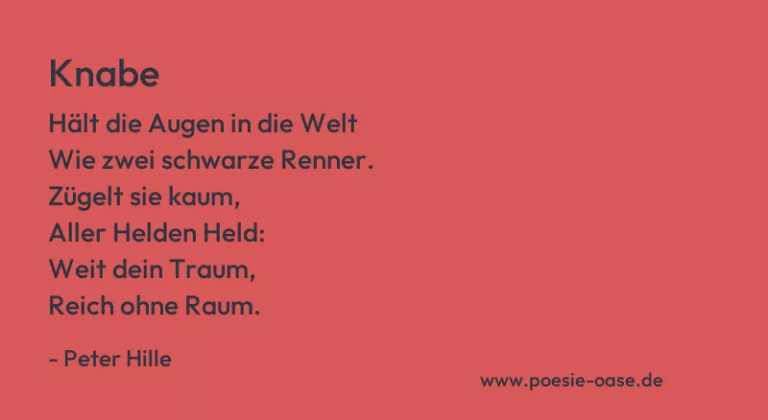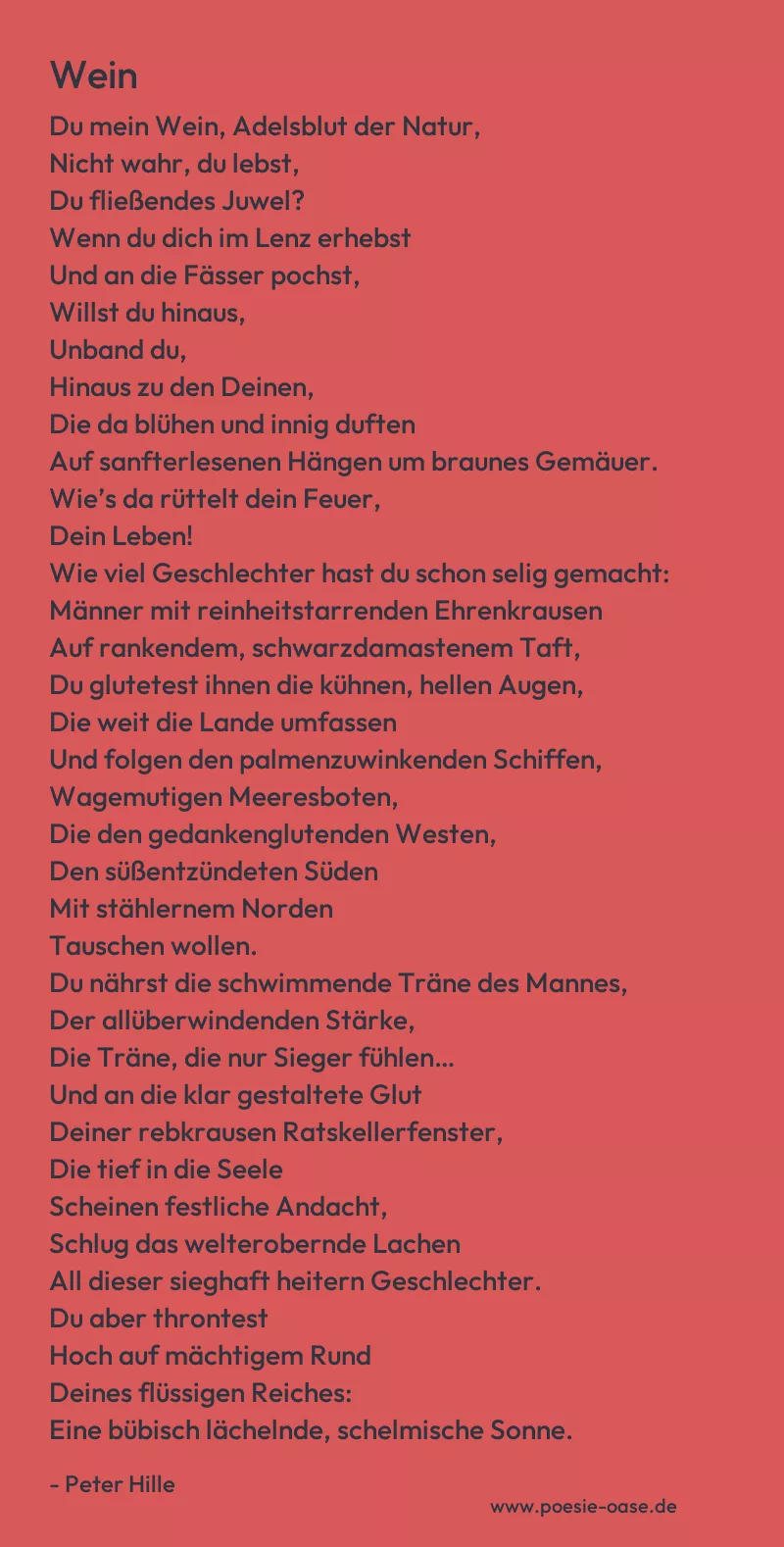Wein
Du mein Wein, Adelsblut der Natur,
Nicht wahr, du lebst,
Du fließendes Juwel?
Wenn du dich im Lenz erhebst
Und an die Fässer pochst,
Willst du hinaus,
Unband du,
Hinaus zu den Deinen,
Die da blühen und innig duften
Auf sanfterlesenen Hängen um braunes Gemäuer.
Wie’s da rüttelt dein Feuer,
Dein Leben!
Wie viel Geschlechter hast du schon selig gemacht:
Männer mit reinheitstarrenden Ehrenkrausen
Auf rankendem, schwarzdamastenem Taft,
Du glutetest ihnen die kühnen, hellen Augen,
Die weit die Lande umfassen
Und folgen den palmenzuwinkenden Schiffen,
Wagemutigen Meeresboten,
Die den gedankenglutenden Westen,
Den süßentzündeten Süden
Mit stählernem Norden
Tauschen wollen.
Du nährst die schwimmende Träne des Mannes,
Der allüberwindenden Stärke,
Die Träne, die nur Sieger fühlen…
Und an die klar gestaltete Glut
Deiner rebkrausen Ratskellerfenster,
Die tief in die Seele
Scheinen festliche Andacht,
Schlug das welterobernde Lachen
All dieser sieghaft heitern Geschlechter.
Du aber throntest
Hoch auf mächtigem Rund
Deines flüssigen Reiches:
Eine bübisch lächelnde, schelmische Sonne.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
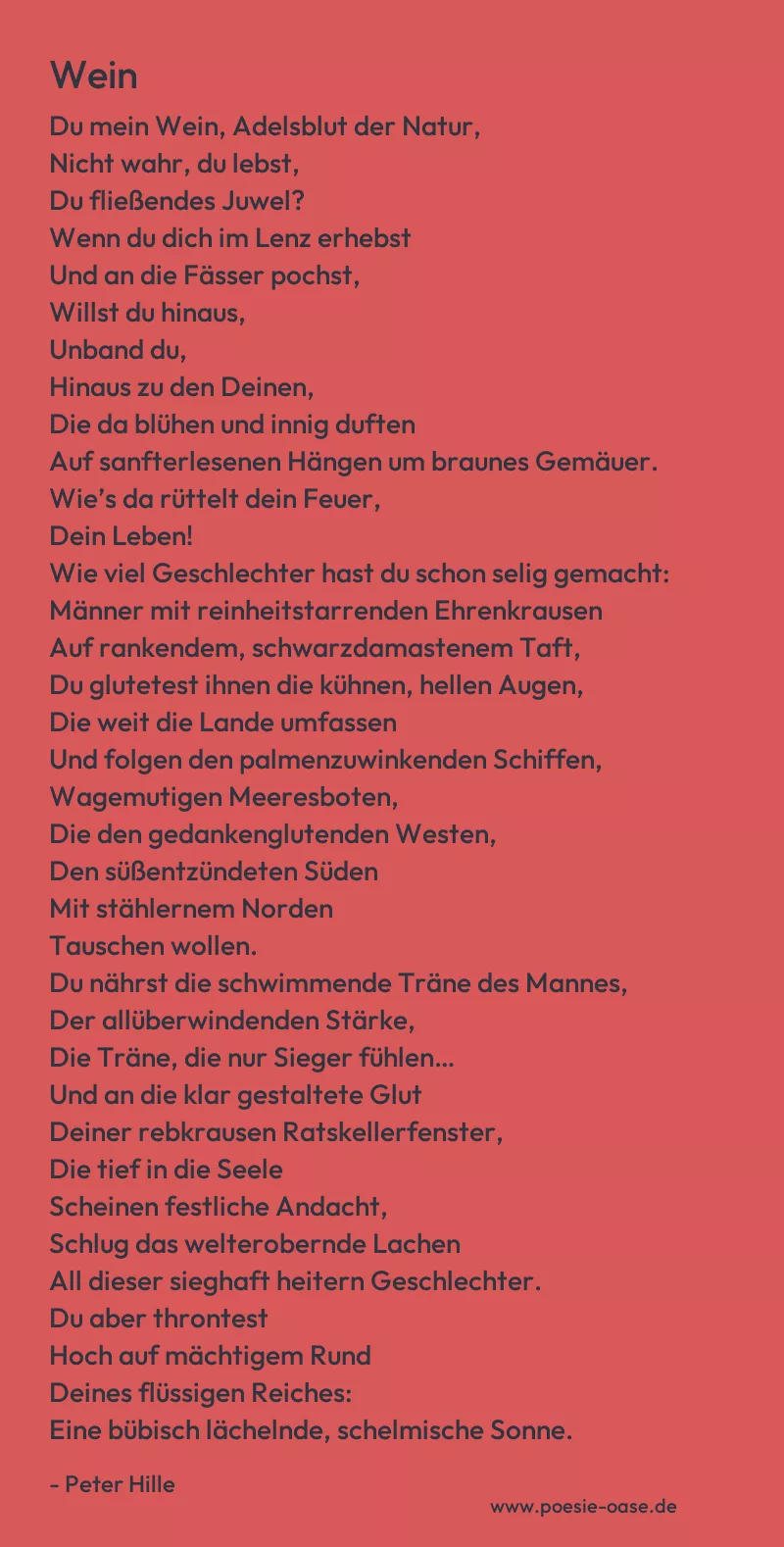
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wein“ von Peter Hille feiert den Wein als kraftvolle, lebensspendende und inspirierende Naturgewalt. Der Wein wird hier personifiziert und als „Adelsblut der Natur“ beschrieben – eine edle Essenz, die sowohl die Natur als auch die Menschen beseelt. Bereits in der Anfangsfrage „Nicht wahr, du lebst“ zeigt sich die Belebtheit und Dynamik, die dem Wein zugeschrieben wird. Das Bild vom „fließenden Juwel“ betont seinen Wert und seine Schönheit, während die Bewegung des Weins vom Fass zu den Weinbergen als Rückkehr zu seiner Herkunft, zu den „Deinen“, verstanden werden kann.
Im weiteren Verlauf beschreibt das lyrische Ich, wie der Wein im Frühling erwacht und zu den Hügeln drängt, wo er Teil der Natur war. Dabei entfaltet sich der Wein als Symbol für Lebensfreude und Erneuerung. Zugleich verweist Hille auf die Geschichte und Tradition des Weingenusses: Männer früherer Zeiten, mit „reinheitstarrenden Ehrenkrausen“ und „schwarzdamastenem Taft“ gekleidet, wurden von der Glut des Weins inspiriert. Diese „kühnen, hellen Augen“ der Männer richten sich auf Entdeckungen und ferne Länder, was den Wein auch als Antriebskraft für Mut und Abenteuer erscheinen lässt.
Ein zentrales Motiv ist die Verbindung von Wein und Heldentum. Der Wein nährt die „schwimmende Träne des Mannes“, ein Symbol für die seltene Rührung selbst der Stärksten. Diese Träne bleibt exklusiv den Siegern vorbehalten und verweist auf eine emotionale Tiefe, die nur der Wein freisetzen kann. Schließlich wird auch die Atmosphäre von Ratskellern und Festen heraufbeschworen: Durch die „rebkrausen Ratskellerfenster“ strahlt der Wein in die Seelen und ruft ein „welteroberndes Lachen“ hervor, das die Lebensfreude und Unbeschwertheit vergangener Generationen spiegelt.
Im Schlussbild wird der Wein zu einer „bübisch lächelnden, schelmischen Sonne“ erhoben, die auf ihrem „flüssigen Reich“ thront. Hier kulminiert die Darstellung des Weins als Lebenselixier, das einerseits Macht und Wärme symbolisiert, andererseits aber auch Leichtigkeit und Schalk. Insgesamt würdigt das Gedicht den Wein als eine Quelle von Kraft, Freude, Inspiration und Gemeinschaft, die die Geschichte vieler Generationen begleitet hat.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.