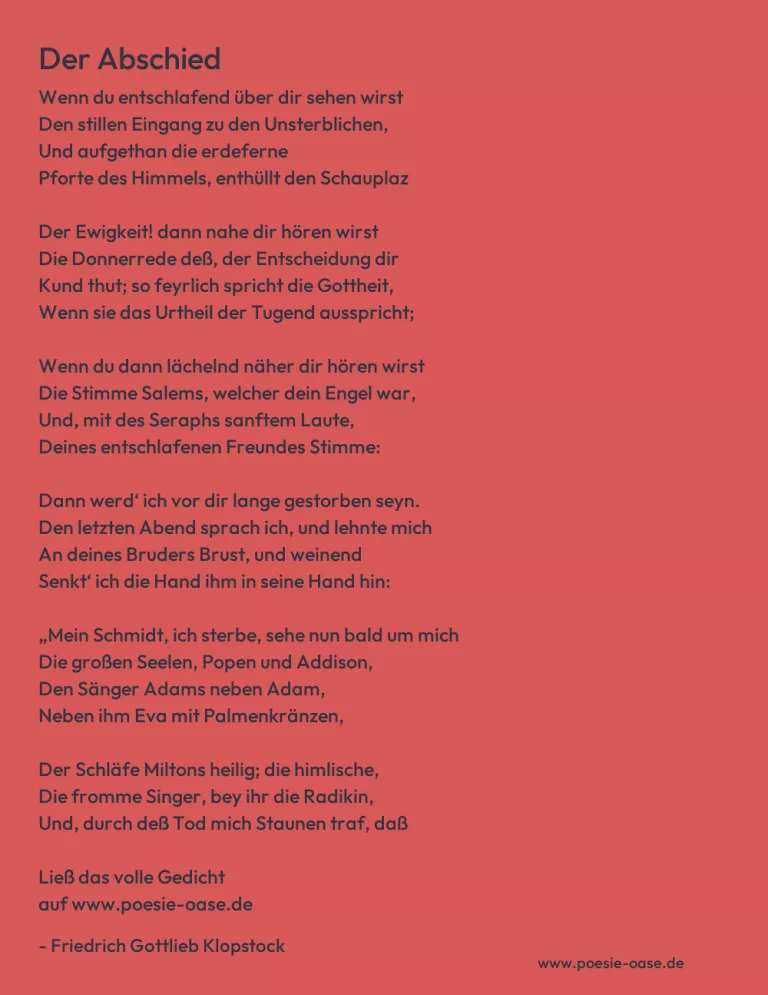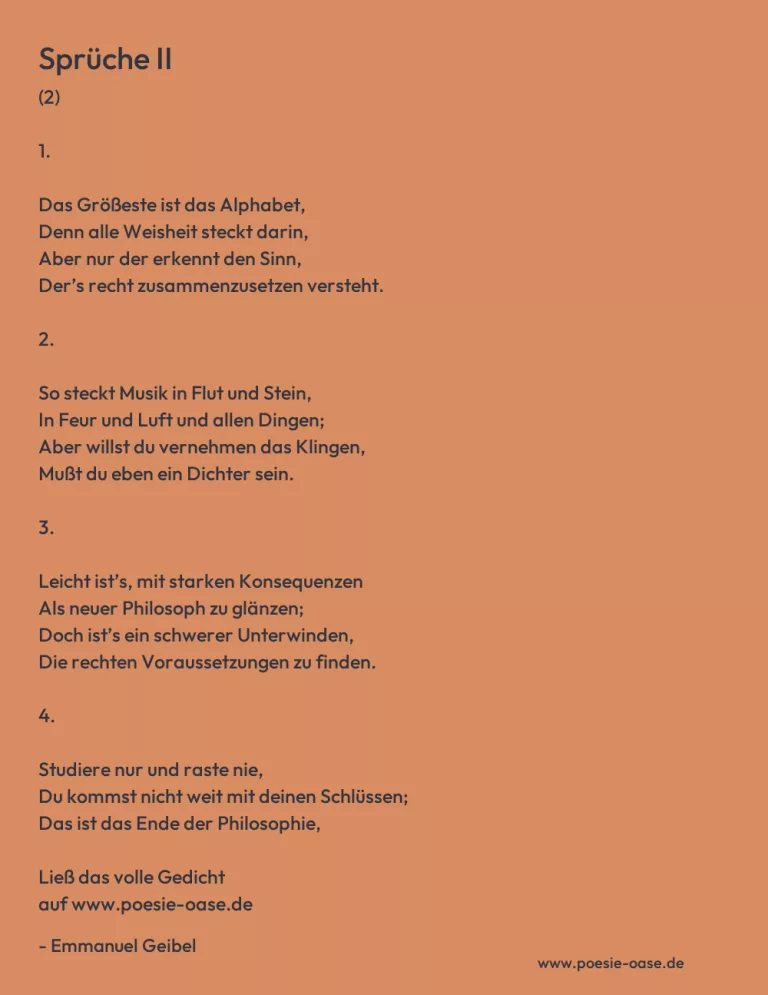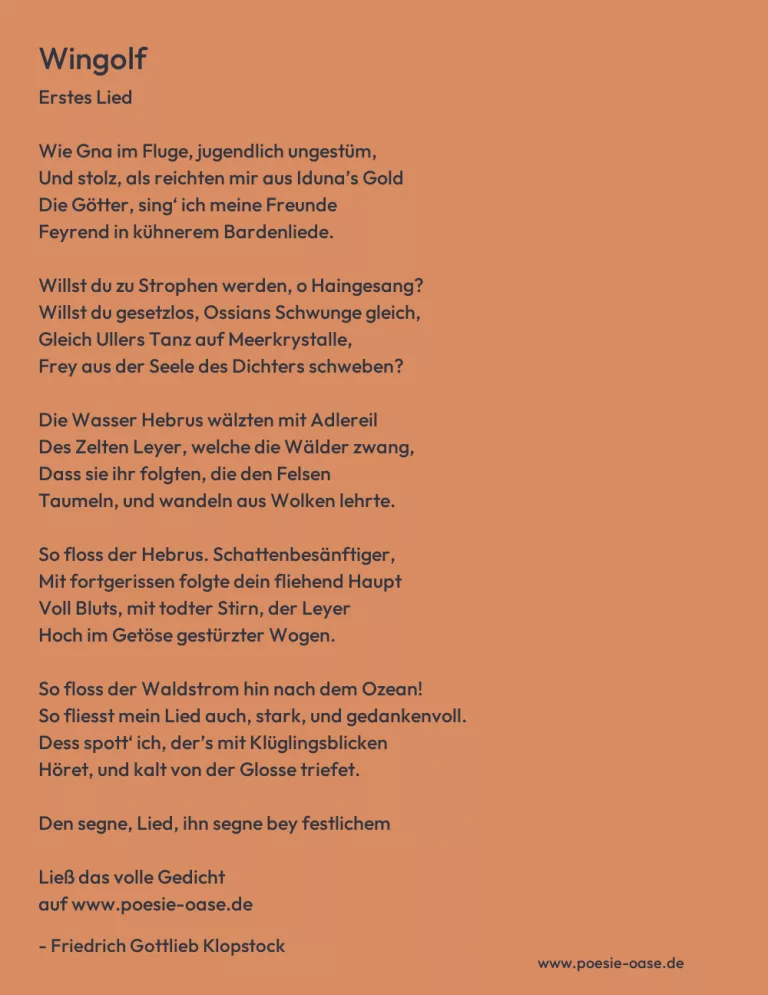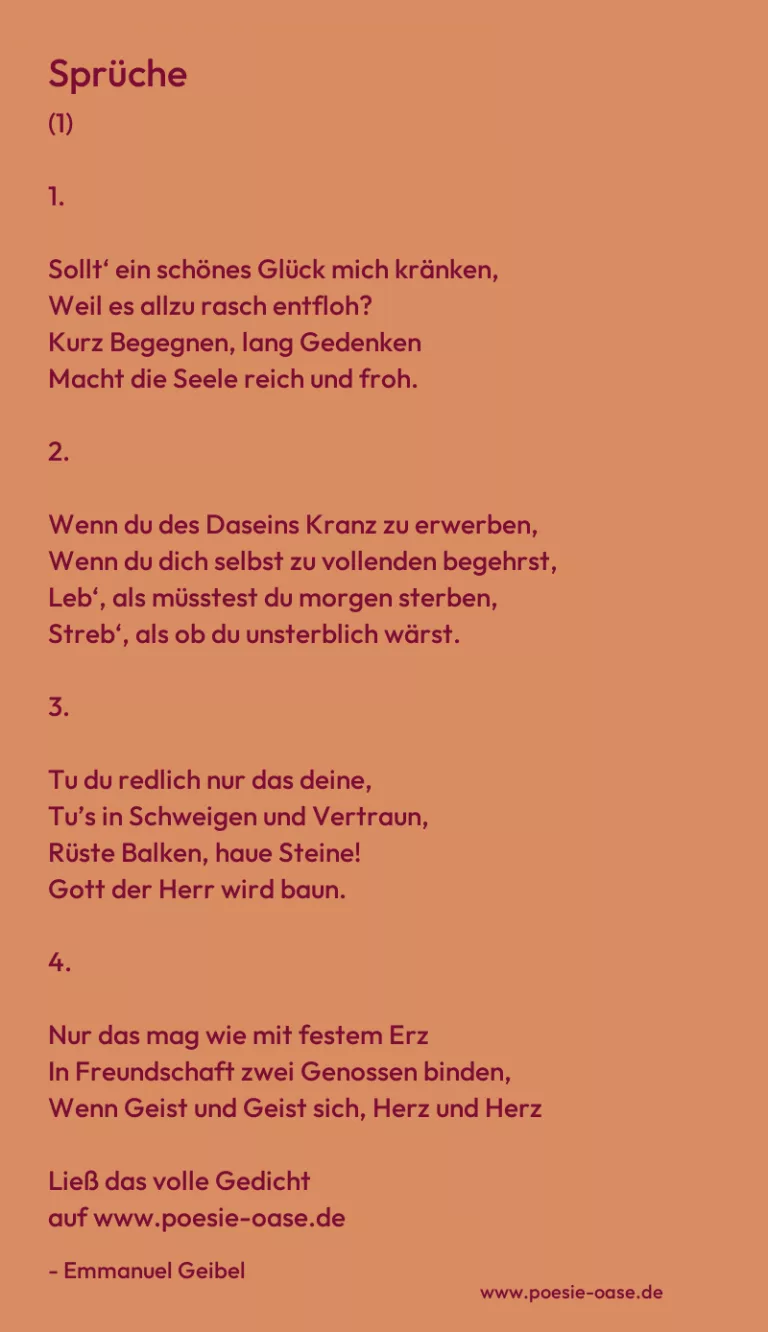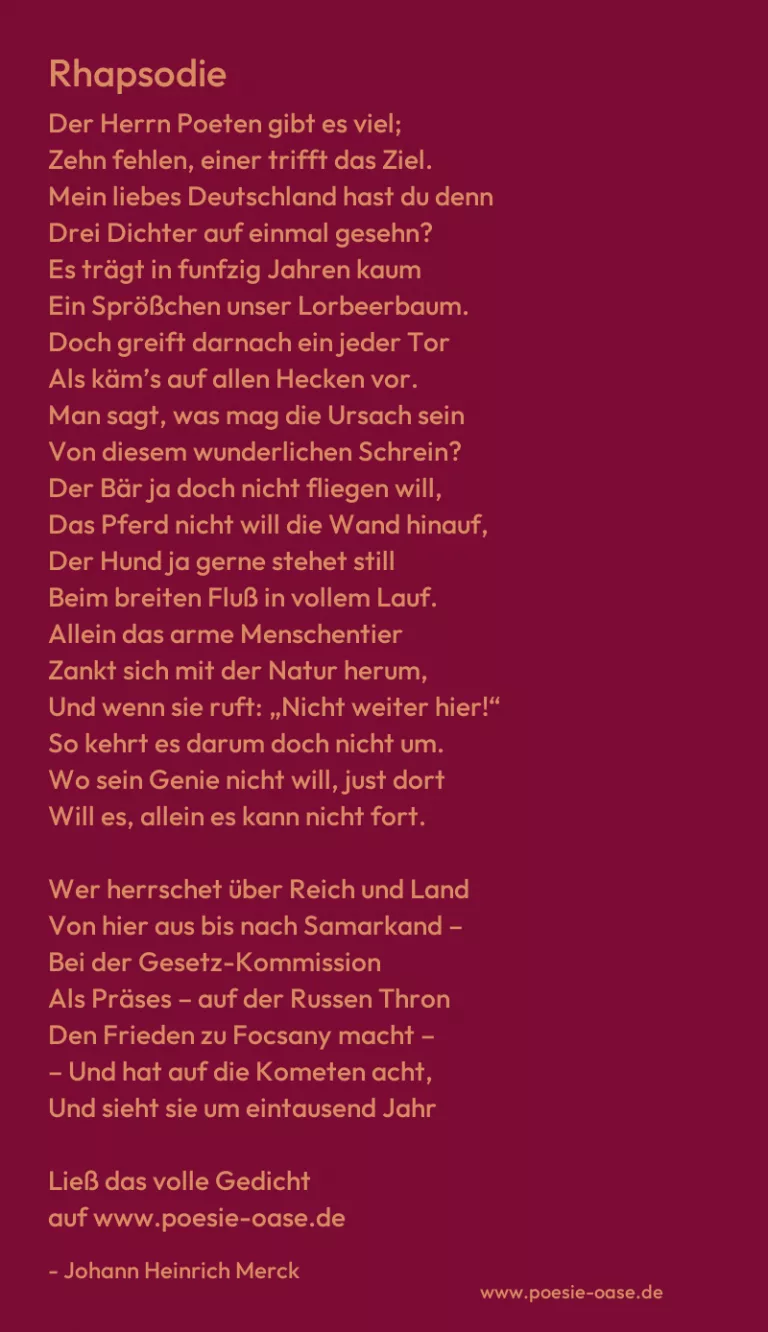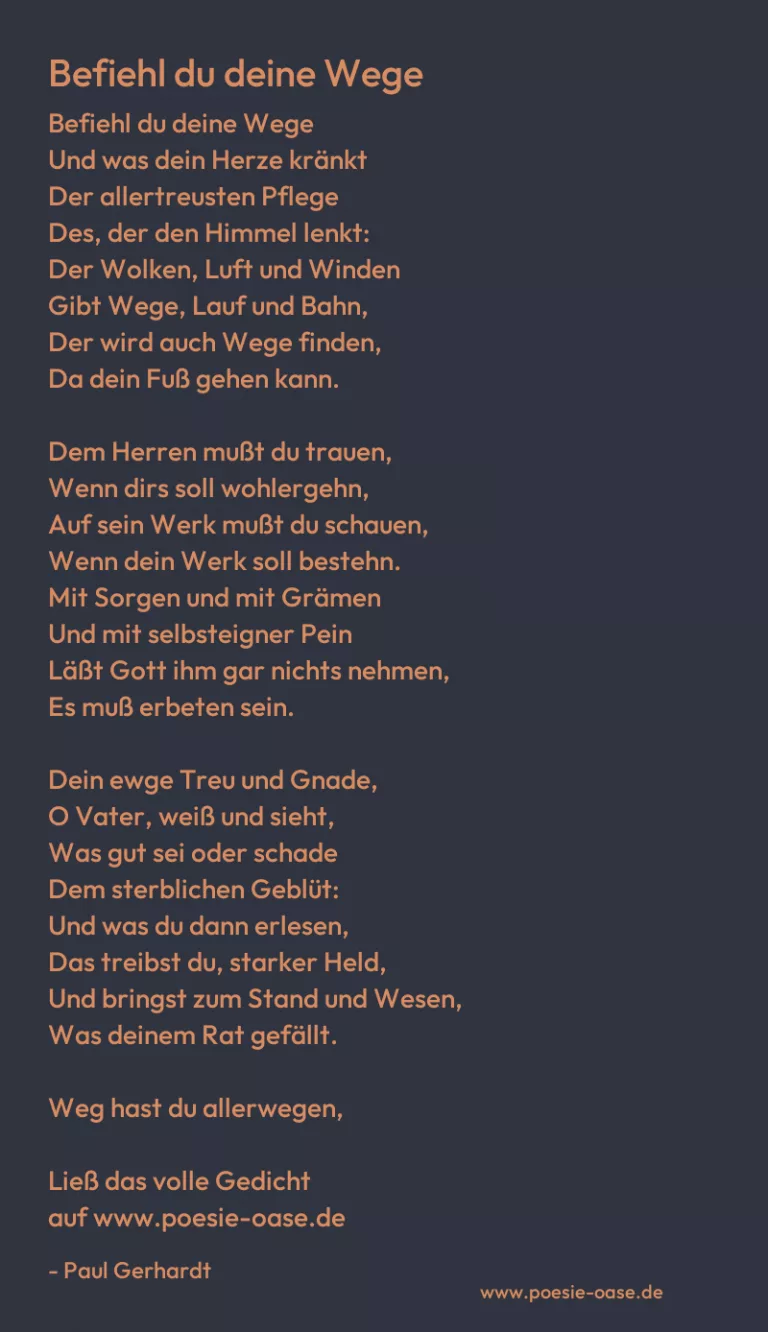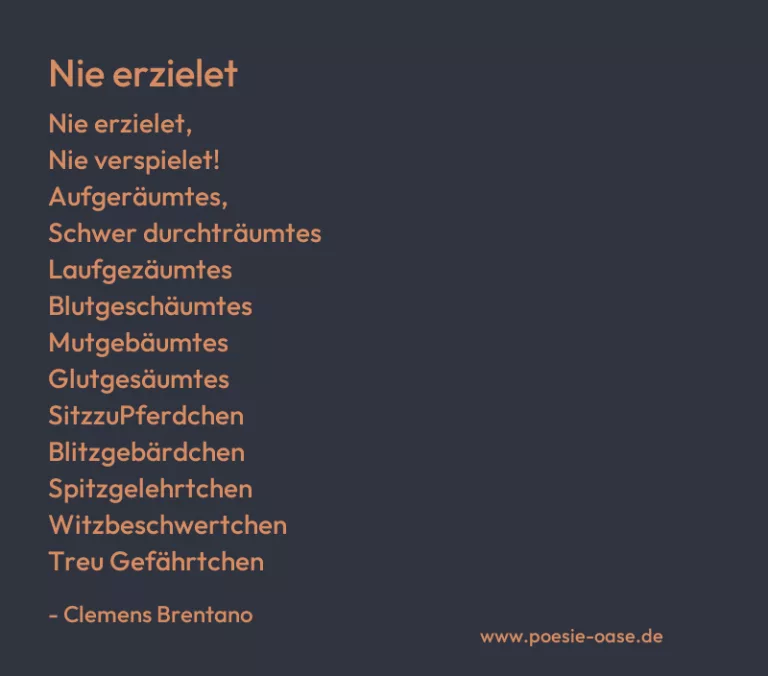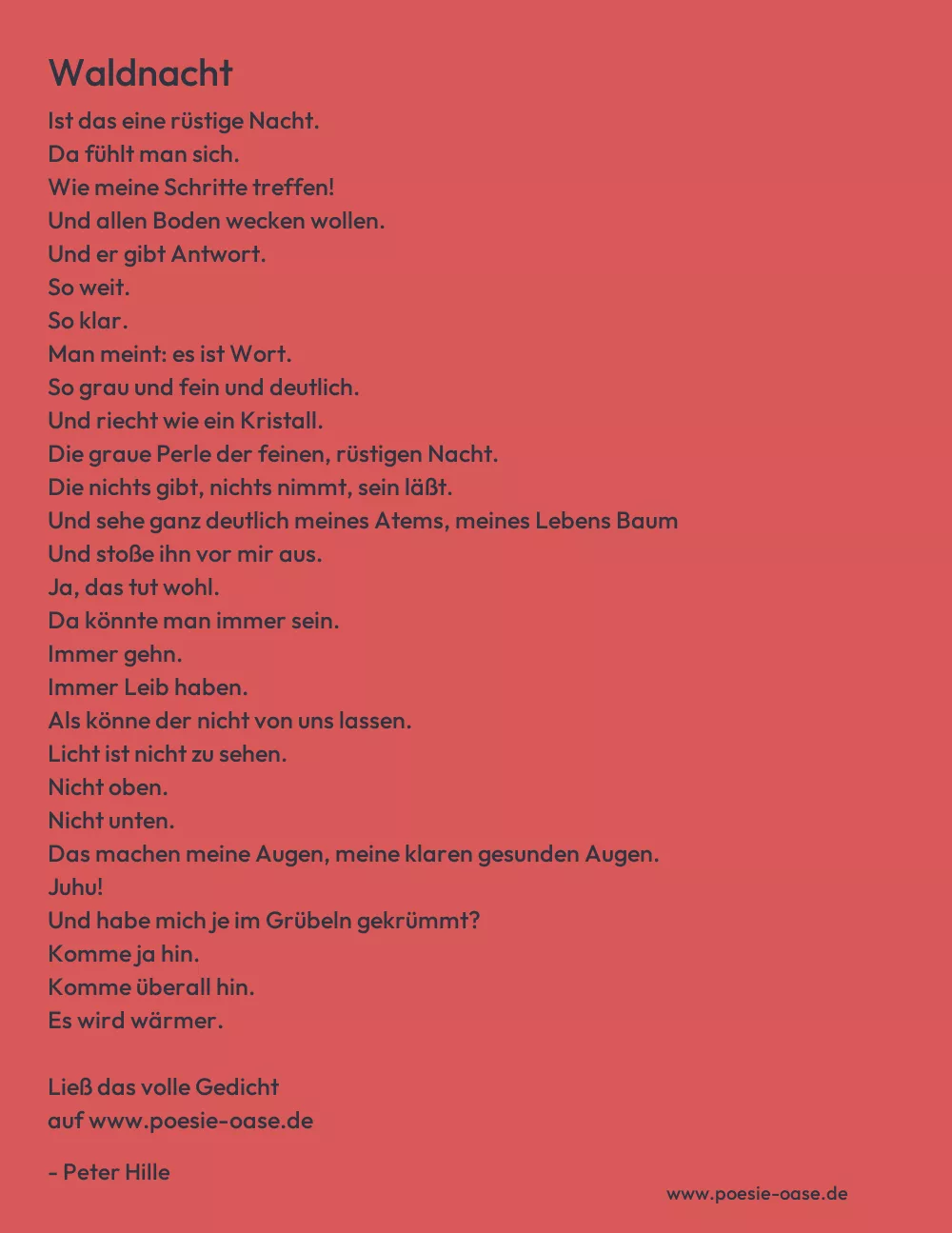Waldnacht
Ist das eine rüstige Nacht.
Da fühlt man sich.
Wie meine Schritte treffen!
Und allen Boden wecken wollen.
Und er gibt Antwort.
So weit.
So klar.
Man meint: es ist Wort.
So grau und fein und deutlich.
Und riecht wie ein Kristall.
Die graue Perle der feinen, rüstigen Nacht.
Die nichts gibt, nichts nimmt, sein läßt.
Und sehe ganz deutlich meines Atems, meines Lebens Baum
Und stoße ihn vor mir aus.
Ja, das tut wohl.
Da könnte man immer sein.
Immer gehn.
Immer Leib haben.
Als könne der nicht von uns lassen.
Licht ist nicht zu sehen.
Nicht oben.
Nicht unten.
Das machen meine Augen, meine klaren gesunden Augen.
Juhu!
Und habe mich je im Grübeln gekrümmt?
Komme ja hin.
Komme überall hin.
Es wird wärmer.
Wohl nur von mir aus.
Ich bin ja alles hier.
Und wie eigen, warm vor Leibhaftigkeit die große, weiße Wolke leuchtet.
Wo kommt sie her?
Was scheint sie an?
Ist ja nirgends Licht zu sehen.
Nirgends Licht, nirgends!
Auch eigen?
Wie ich.
Und lockt so stark, so wollüstig wie sonst des
Weibes schwellend uns empörender Frieden.
Und so keusch wie nur die weite Welt.
Das ganz Durchdrungene.
Ich lese mich zurück, lese mich weiter, lese mich
aus allen nahenden, beflissen farbigen Mantelgestalten des Haines.
Kein Lied fällt nieder.
Kein Vogeltraum.
Wir selbst sind Leben.
Eigenes Leben.
Und einen Rausch habe ich.
Höher als der von blödem Gegorenen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
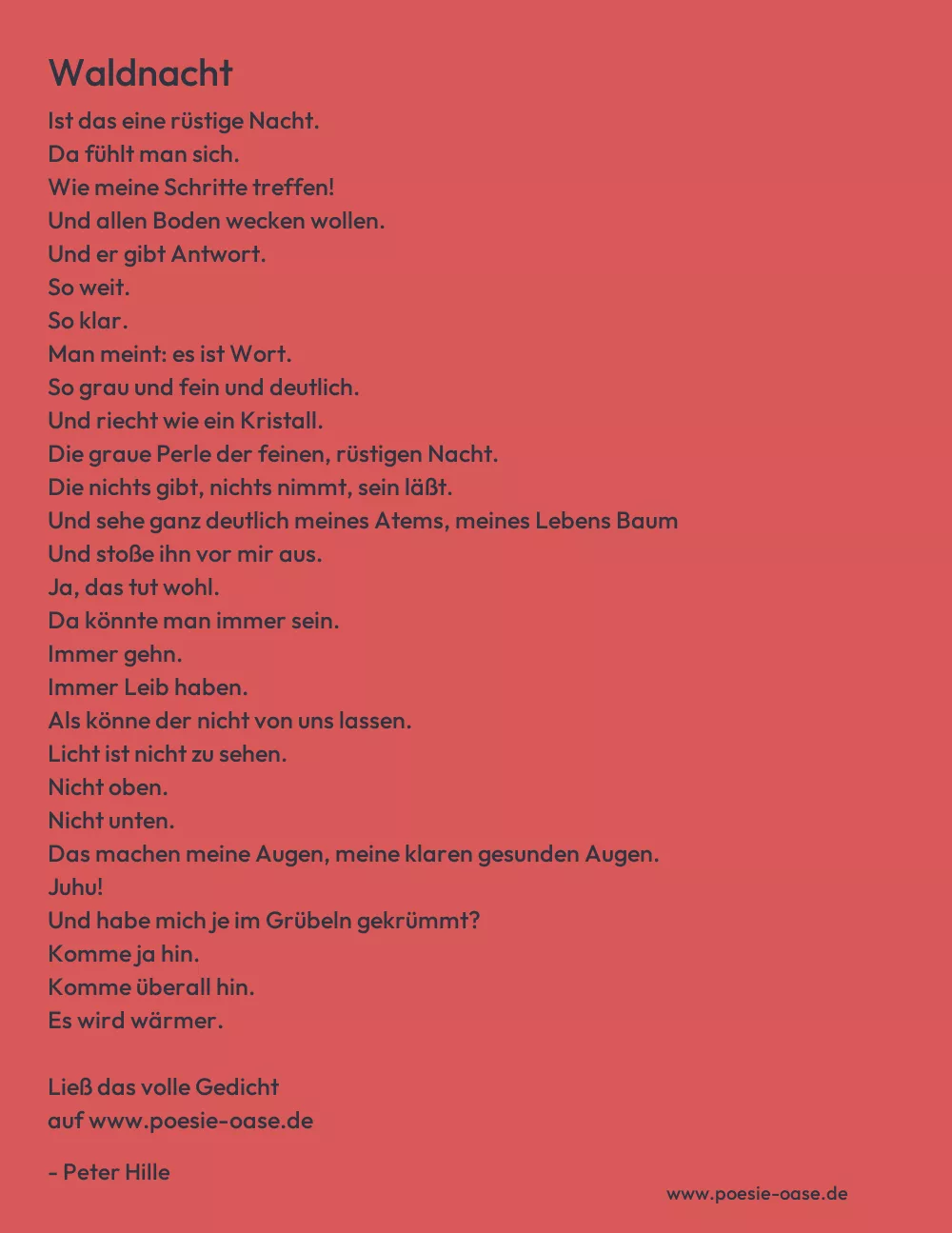
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Waldnacht“ von Peter Hille beschreibt eine intensive Natur- und Selbsterfahrung in der nächtlichen Einsamkeit des Waldes. Die „rüstige Nacht“ wird als kraftvoll und belebt geschildert, und das lyrische Ich empfindet sich in dieser Umgebung besonders präsent und stark. Die Schritte wirken fast magisch, da sie den Boden zu „wecken“ scheinen und der Wald selbst „Antwort“ gibt. Diese Kommunikation zwischen Mensch und Natur hebt die Szene über das Alltägliche hinaus und verleiht ihr eine fast mystische Dimension.
Die Natur erscheint hier nicht nur als Umgebung, sondern als ein Raum, in dem das lyrische Ich ganz zu sich selbst findet. In der Dunkelheit, in der „kein Licht“ zu sehen ist – weder „oben“ noch „unten“ – übernimmt der eigene Körper die Funktion des Lichts. Das Bewusstsein wird so stark, dass das Ich sich selbst als das Zentrum dieser Welt empfindet: „Ich bin ja alles hier.“ In dieser Dunkelheit und Stille kommt es zu einer Selbstermächtigung und einer intensiven Wahrnehmung der eigenen Leibhaftigkeit.
Besonders kraftvoll wirkt das Bild der „weißen Wolke“, die plötzlich warm und leuchtend erscheint, obwohl keinerlei Lichtquelle auszumachen ist. Die Wolke wird dabei doppeldeutig beschrieben: einerseits sinnlich und verlockend, „wie des Weibes schwellend uns empörender Frieden“, andererseits „keusch wie nur die weite Welt“. Diese Ambivalenz spiegelt die Vereinigung von sinnlicher Lust und spiritueller Reinheit wider, die in dieser Nacht erfahrbar wird.
Im letzten Abschnitt verstärkt sich das Gefühl der Autonomie. Das lyrische Ich zieht sich von allen „Mantelgestalten des Haines“ zurück und erlebt sich selbst als das einzige, wahre Leben. Die Abwesenheit von äußeren Geräuschen und Liedern („Kein Lied fällt nieder“) unterstreicht die innere Versenkung. Der „Rausch“, von dem das Ich spricht, ist nicht der eines gewöhnlichen Rausches, sondern ein ekstatisches Empfinden, das aus der Verschmelzung von Natur, Nacht und Selbst herrührt. „Waldnacht“ ist somit eine Feier der Einsamkeit, der Natur als Spiegel des eigenen Seins und der Erfahrung des Selbst als Teil eines größeren, durchdrungenen Ganzen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.