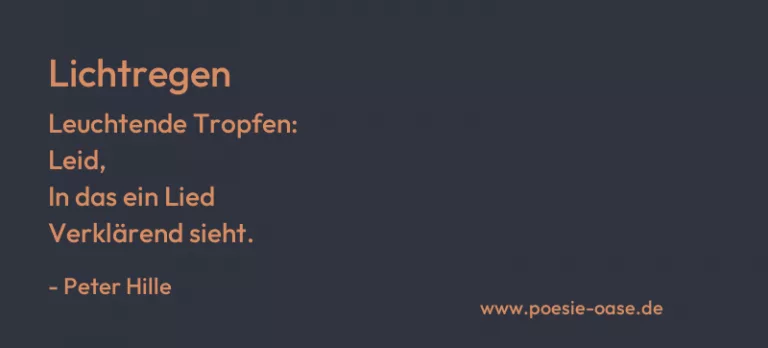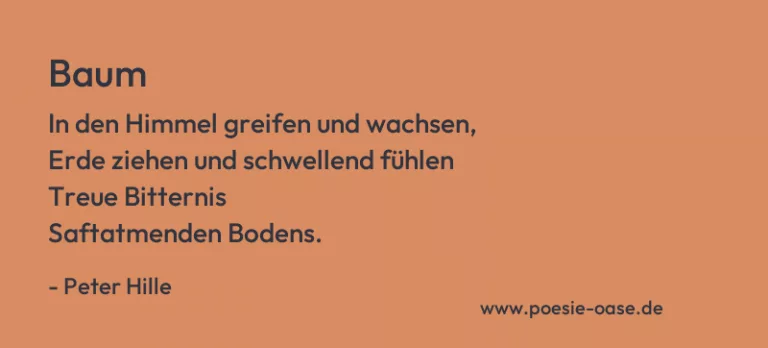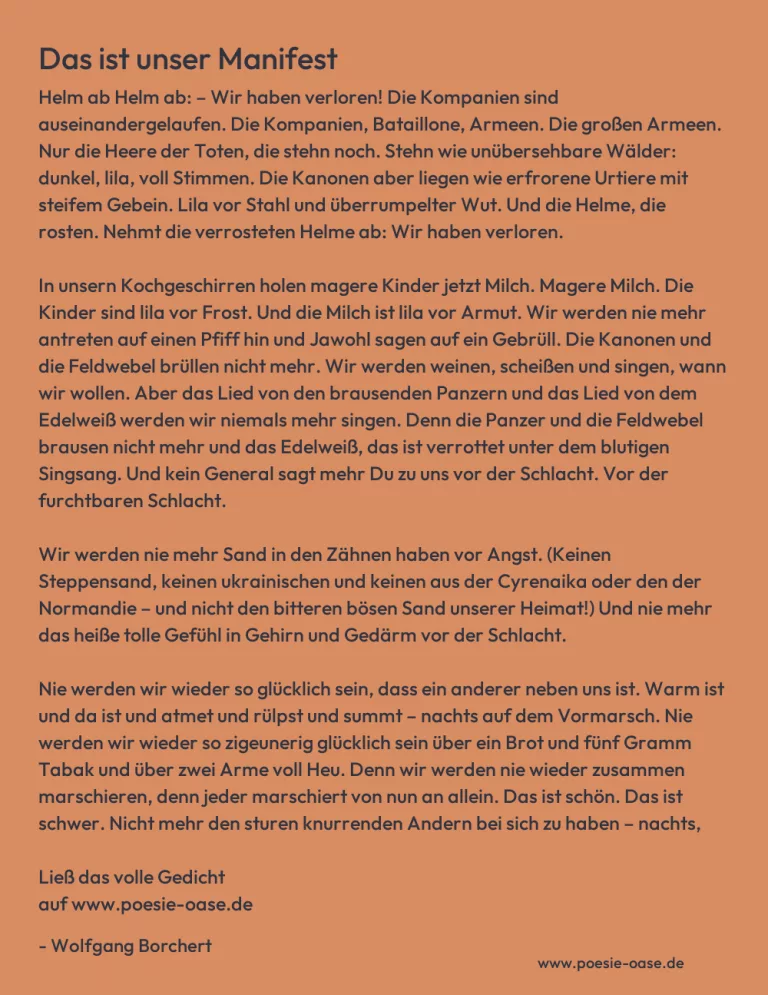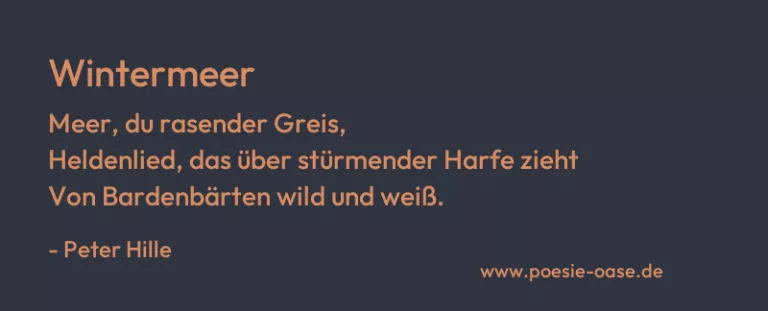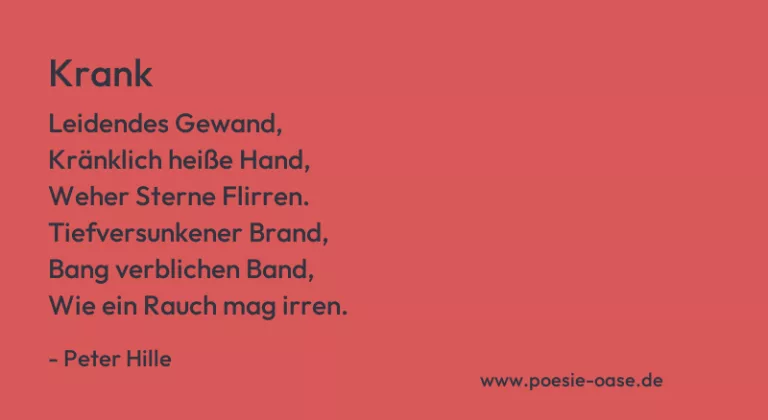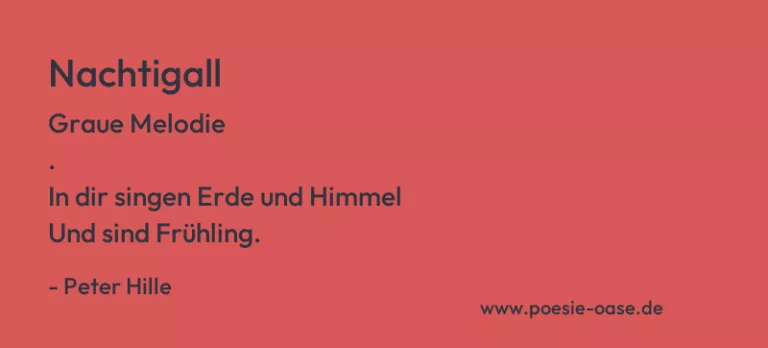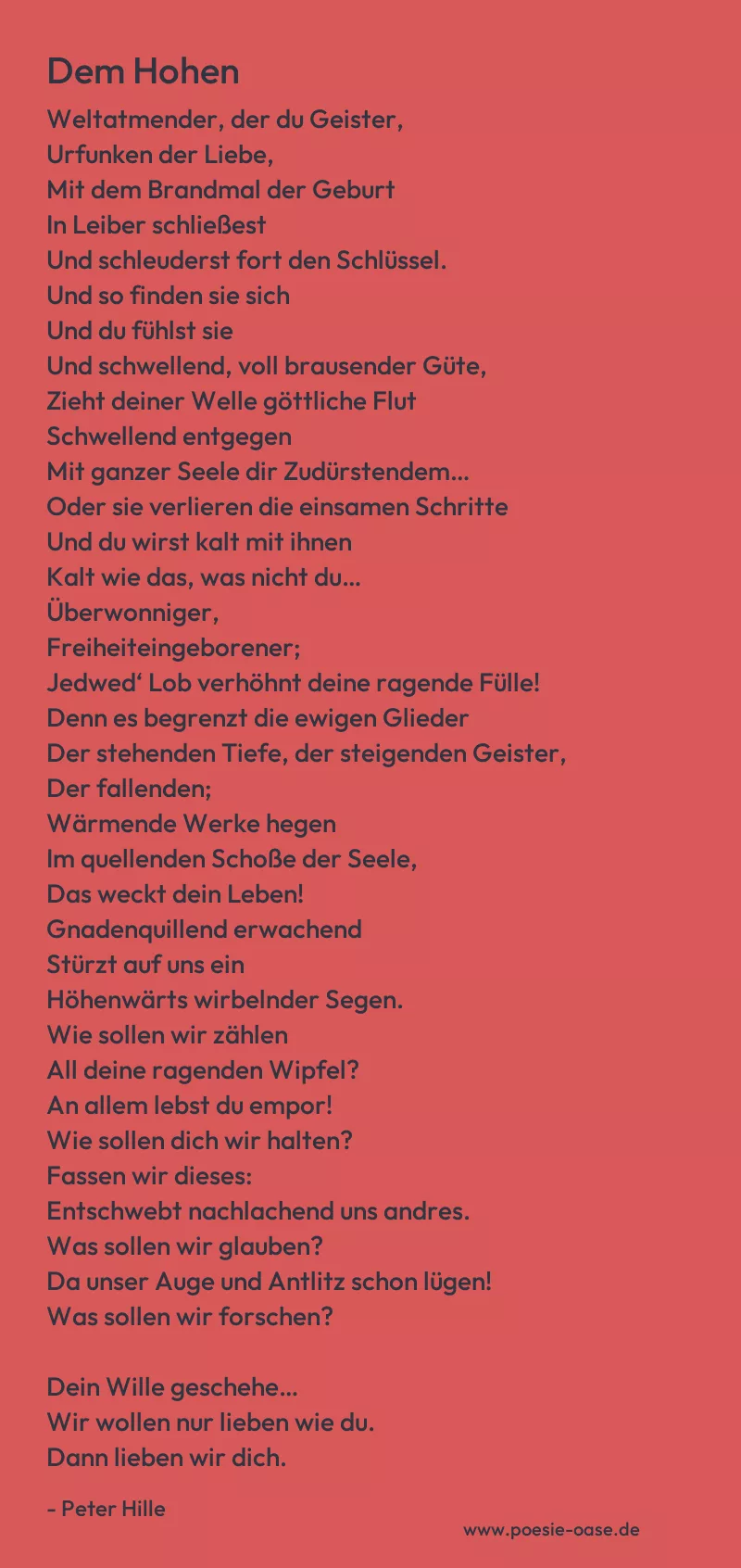Dem Hohen
Weltatmender, der du Geister,
Urfunken der Liebe,
Mit dem Brandmal der Geburt
In Leiber schließest
Und schleuderst fort den Schlüssel.
Und so finden sie sich
Und du fühlst sie
Und schwellend, voll brausender Güte,
Zieht deiner Welle göttliche Flut
Schwellend entgegen
Mit ganzer Seele dir Zudürstendem…
Oder sie verlieren die einsamen Schritte
Und du wirst kalt mit ihnen
Kalt wie das, was nicht du…
Überwonniger,
Freiheiteingeborener;
Jedwed‘ Lob verhöhnt deine ragende Fülle!
Denn es begrenzt die ewigen Glieder
Der stehenden Tiefe, der steigenden Geister,
Der fallenden;
Wärmende Werke hegen
Im quellenden Schoße der Seele,
Das weckt dein Leben!
Gnadenquillend erwachend
Stürzt auf uns ein
Höhenwärts wirbelnder Segen.
Wie sollen wir zählen
All deine ragenden Wipfel?
An allem lebst du empor!
Wie sollen dich wir halten?
Fassen wir dieses:
Entschwebt nachlachend uns andres.
Was sollen wir glauben?
Da unser Auge und Antlitz schon lügen!
Was sollen wir forschen?
Dein Wille geschehe…
Wir wollen nur lieben wie du.
Dann lieben wir dich.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
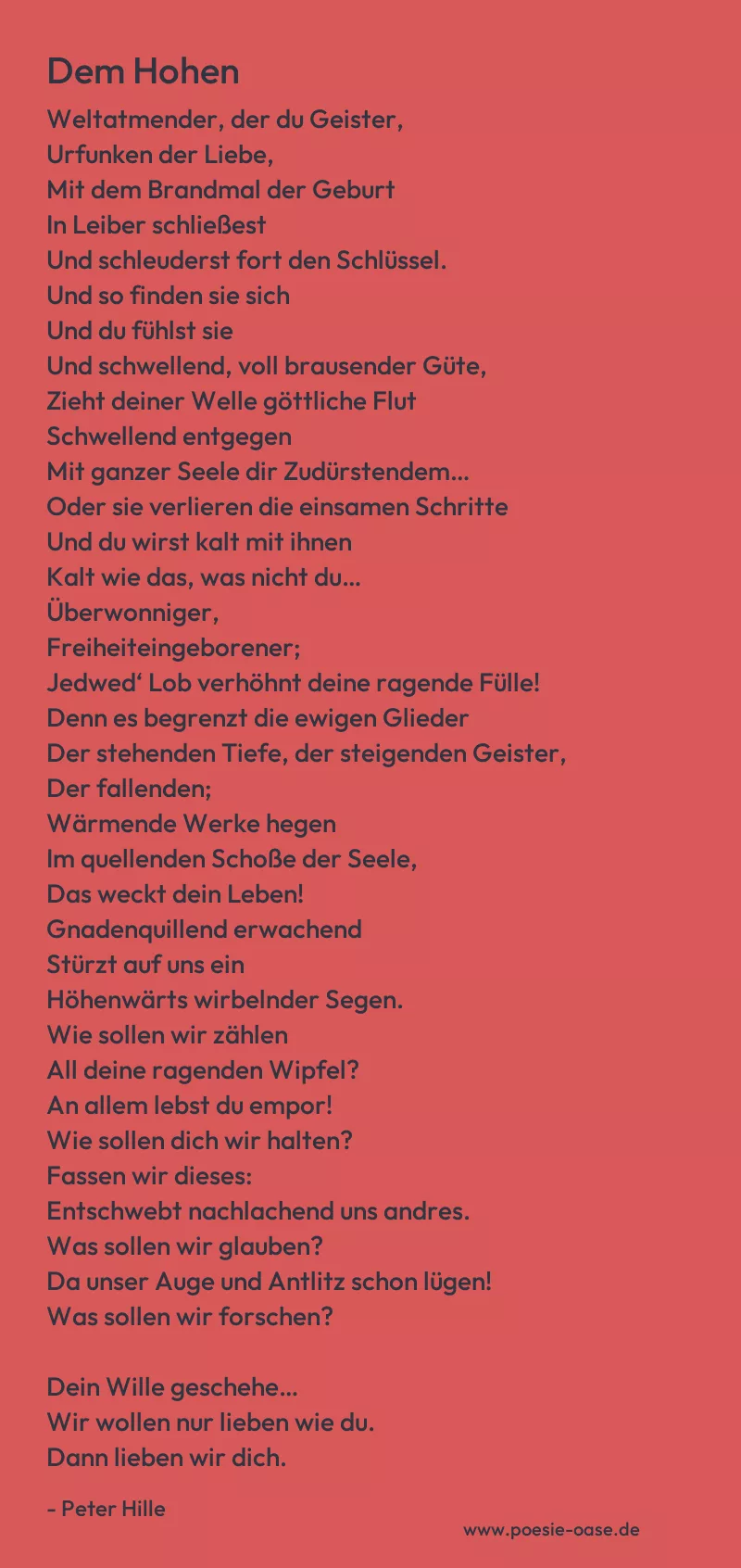
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Dem Hohen“ von Peter Hille ist eine hymnische und zugleich tiefphilosophische Auseinandersetzung mit einer höheren, göttlichen Kraft, die als Weltenschöpfer und Urquelle beschrieben wird. Bereits zu Beginn wird diese Kraft als „Weltatmender“ angesprochen – ein Bild, das die Verbindung zwischen Kosmos und Leben herstellt. Die „Urfunken der Liebe“ deutet Hille als Ursprung der Schöpfung, die in Körper „geschlossen“ und durch den „Schlüssel“ der Geburt voneinander getrennt werden. Hier entsteht das Bild eines göttlichen Prinzips, das die Seelen aussendet und zugleich selbst Teil der ewigen Einheit bleibt.
Das Gedicht thematisiert dabei die Gegensätze von Nähe und Ferne, Wärme und Kälte, göttlicher Güte und Verlorenheit. Wer sich dem „Weltatmenden“ öffnet, spürt die „brausende Güte“ und wird von einer „göttlichen Flut“ durchströmt. Wer jedoch diese Verbindung verliert, erfährt das Göttliche als „kalt“ und fern – eine Entfremdung, die sich in der Einsamkeit der „verlorenen Schritte“ ausdrückt. Hille zeigt so den Zwiespalt der menschlichen Existenz zwischen göttlicher Verbundenheit und existenzieller Isolation.
In der zweiten Hälfte des Gedichts steigert sich die Sprache in eine ekstatische Beschreibung der göttlichen Größe. Das „Höhere“ wird als „Überwonniger“ und „Freiheiteingeborener“ bezeichnet – es steht über aller menschlichen Vorstellungskraft und entzieht sich jeder Einengung durch Worte oder Lob. Die Naturbilder der „ragenden Wipfel“ und des „quellenden Schoßes der Seele“ zeigen das Göttliche als eine unaufhaltsame, lebendige Kraft, die stetig neu schöpft und emporwächst.
Das Gedicht endet mit der Erkenntnis, dass weder das Denken noch das Forschen das Göttliche fassen können. Stattdessen bietet Hille als Lösung die Liebe an: Nur wer liebt „wie du“ – wie das Göttliche selbst – findet wirkliche Nähe zu dieser Macht. Damit führt der Text zu einer spirituellen Einsicht, die die Begrenztheit des Verstandes anerkennt und die Liebe als höchste Form der Verbindung zum Transzendenten versteht. Das Gedicht vereint somit mystische Bildsprache mit philosophischem Nachdenken über die Beziehung zwischen Mensch und Gott.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.