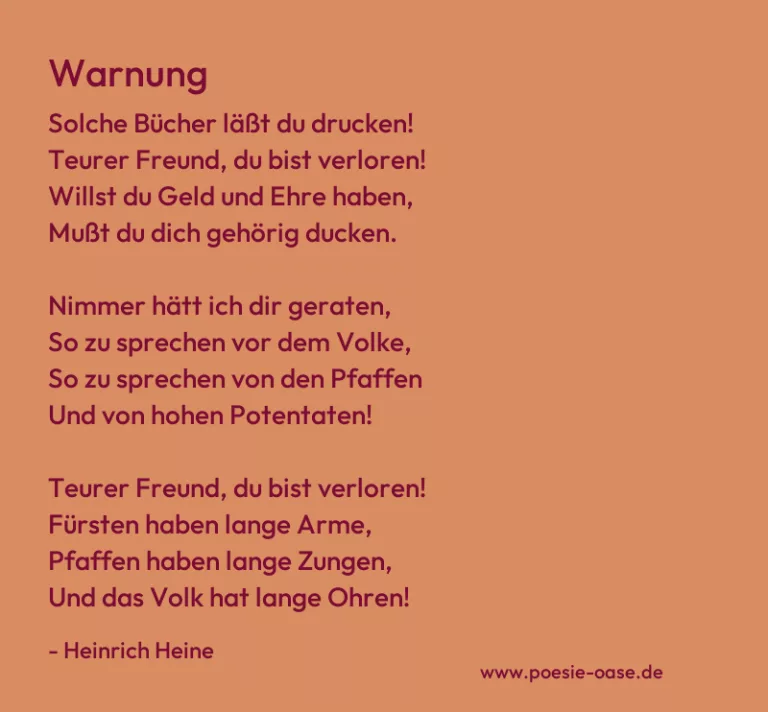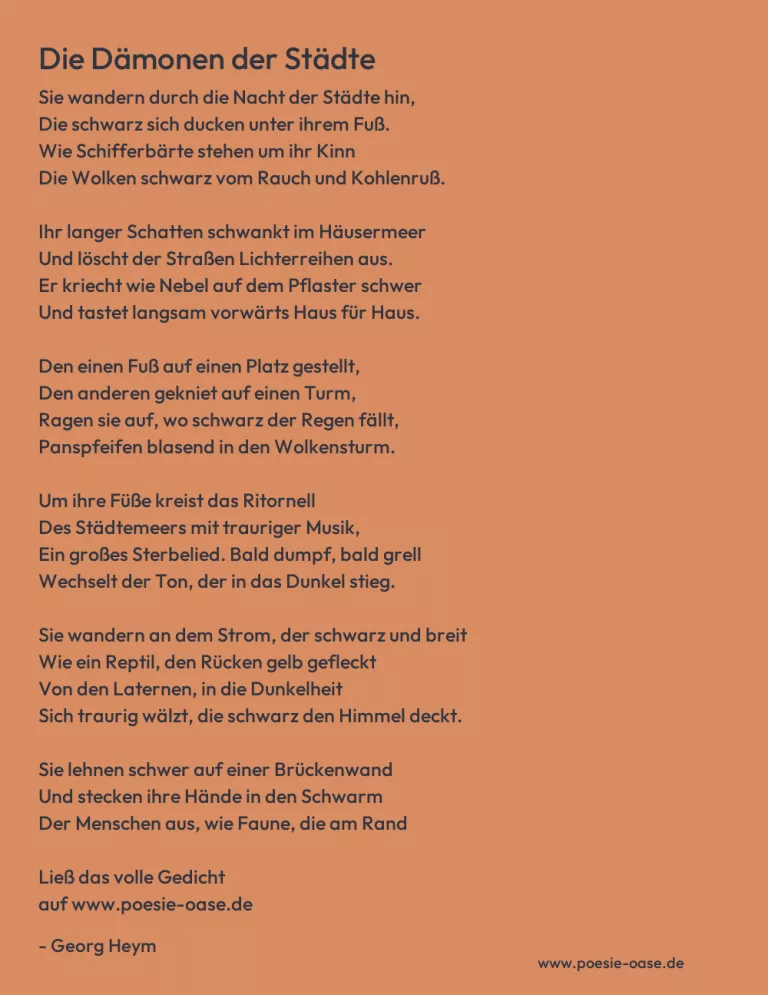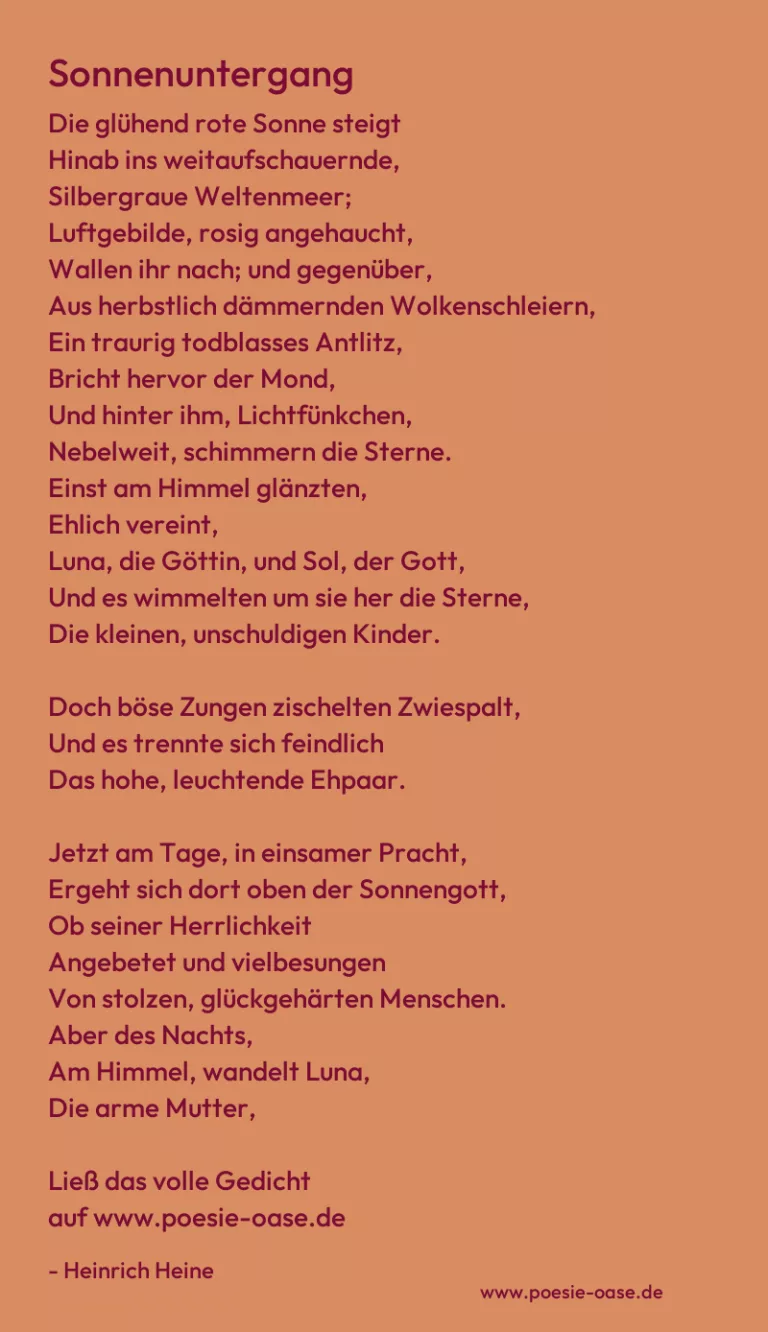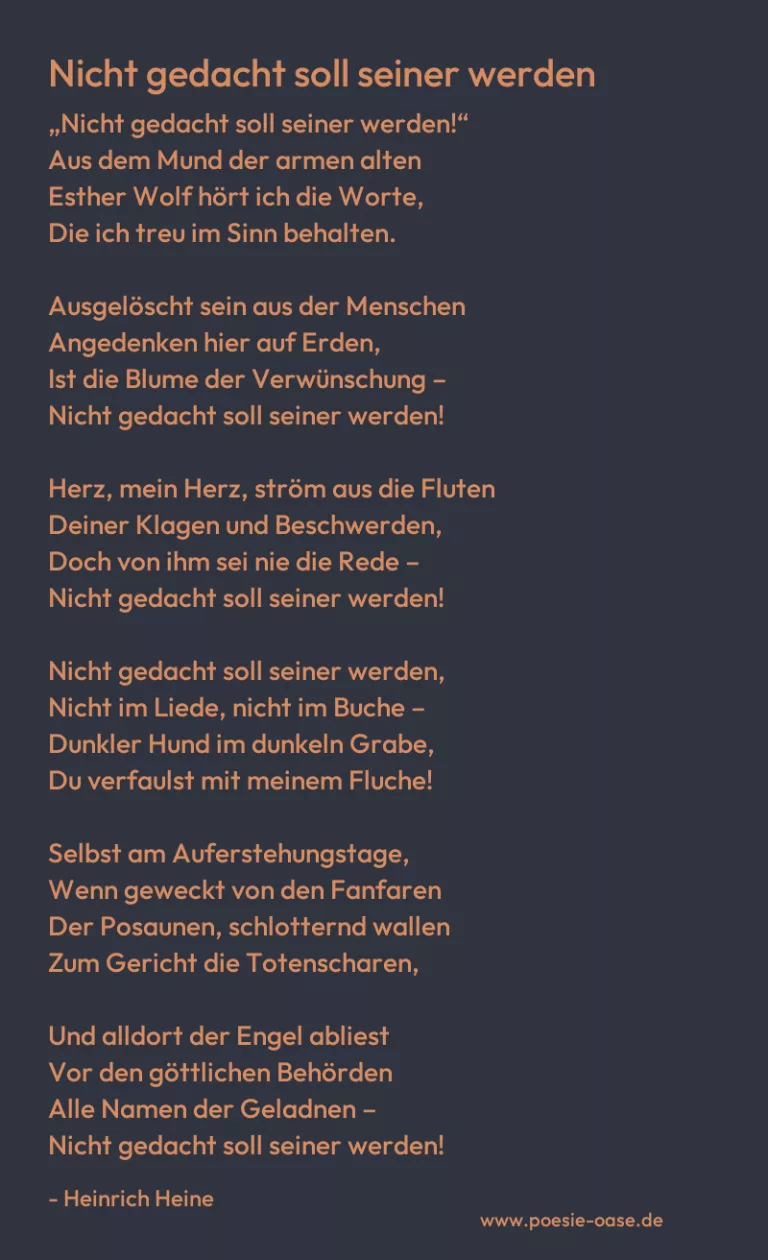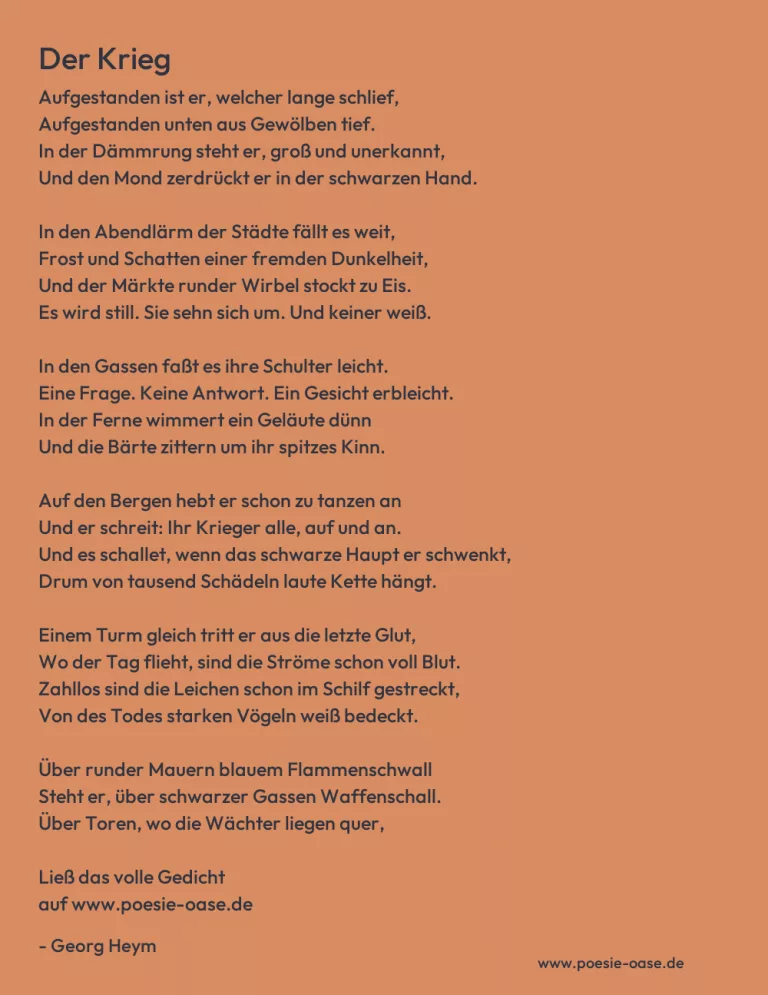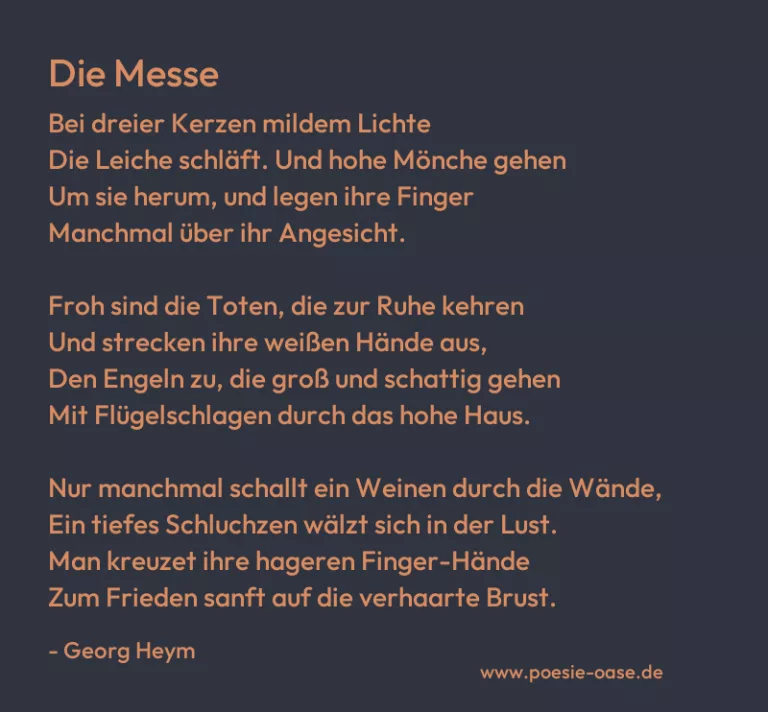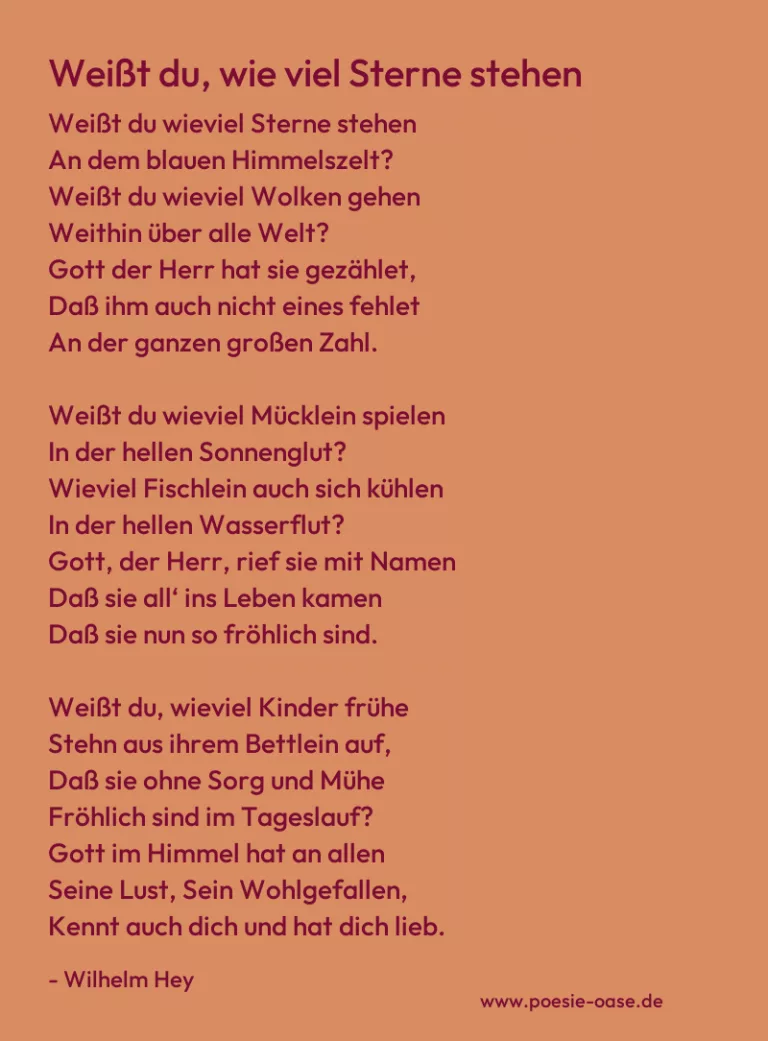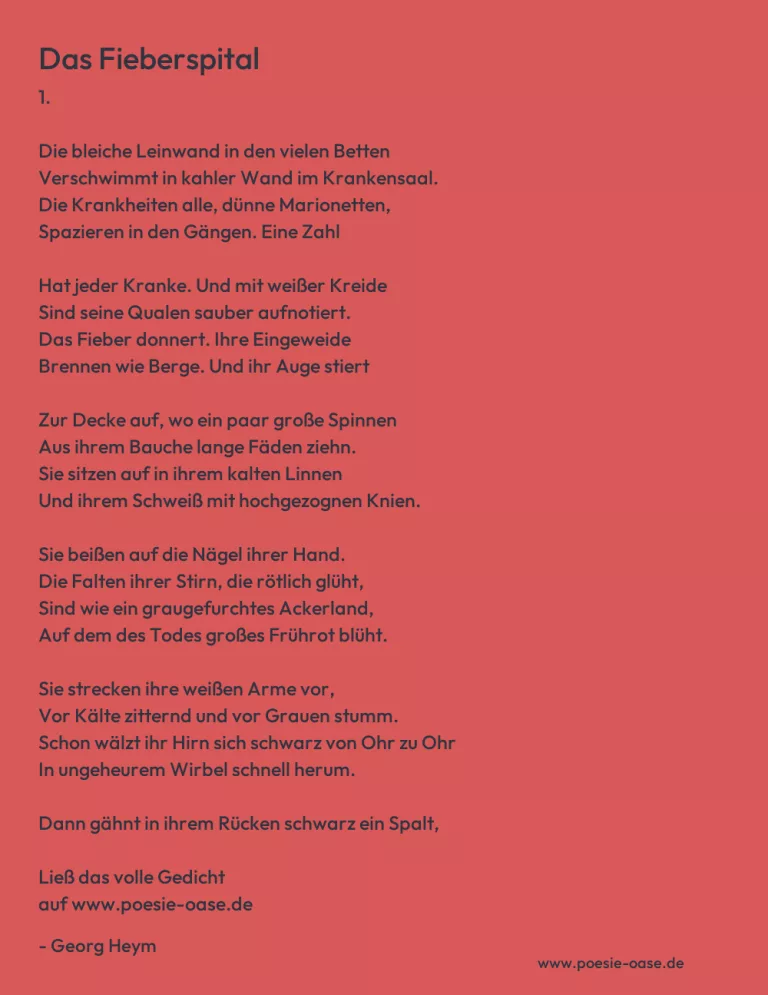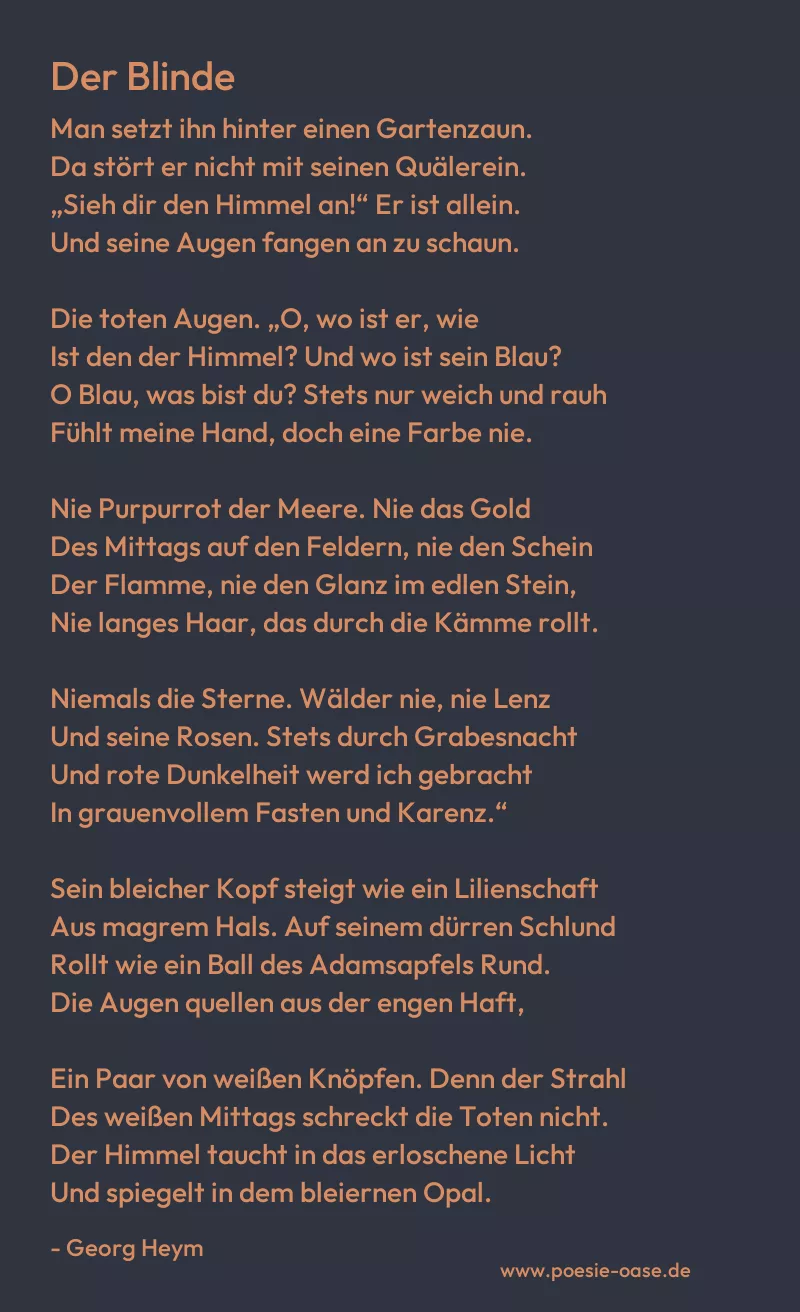Man setzt ihn hinter einen Gartenzaun.
Da stört er nicht mit seinen Quälerein.
„Sieh dir den Himmel an!“ Er ist allein.
Und seine Augen fangen an zu schaun.
Die toten Augen. „O, wo ist er, wie
Ist den der Himmel? Und wo ist sein Blau?
O Blau, was bist du? Stets nur weich und rauh
Fühlt meine Hand, doch eine Farbe nie.
Nie Purpurrot der Meere. Nie das Gold
Des Mittags auf den Feldern, nie den Schein
Der Flamme, nie den Glanz im edlen Stein,
Nie langes Haar, das durch die Kämme rollt.
Niemals die Sterne. Wälder nie, nie Lenz
Und seine Rosen. Stets durch Grabesnacht
Und rote Dunkelheit werd ich gebracht
In grauenvollem Fasten und Karenz.“
Sein bleicher Kopf steigt wie ein Lilienschaft
Aus magrem Hals. Auf seinem dürren Schlund
Rollt wie ein Ball des Adamsapfels Rund.
Die Augen quellen aus der engen Haft,
Ein Paar von weißen Knöpfen. Denn der Strahl
Des weißen Mittags schreckt die Toten nicht.
Der Himmel taucht in das erloschene Licht
Und spiegelt in dem bleiernen Opal.