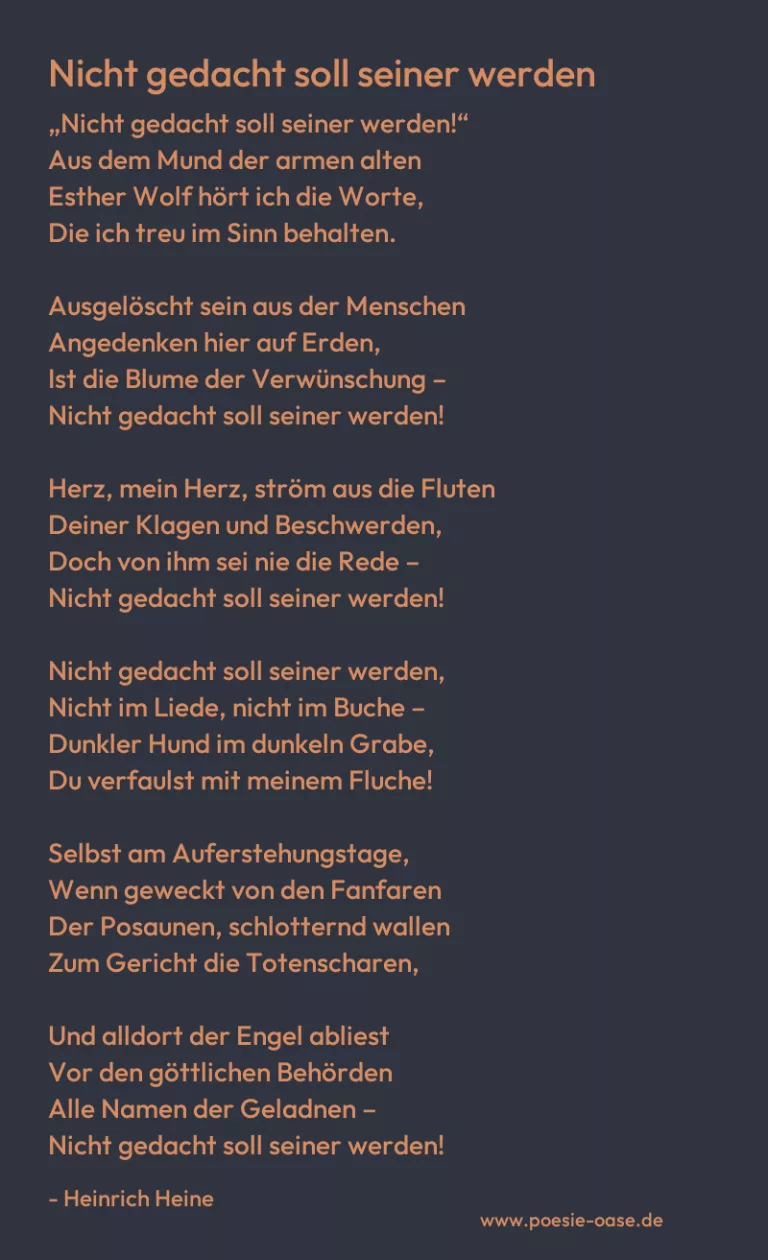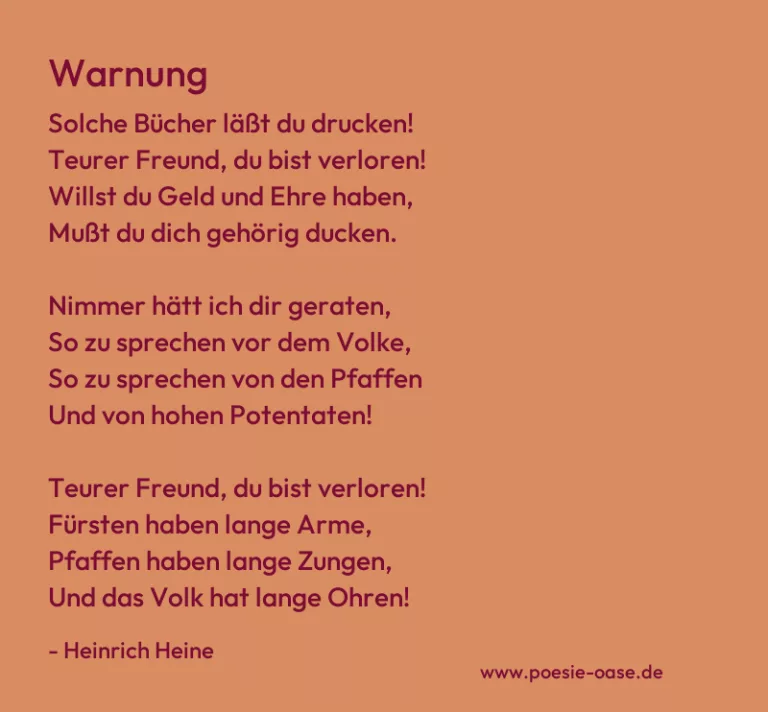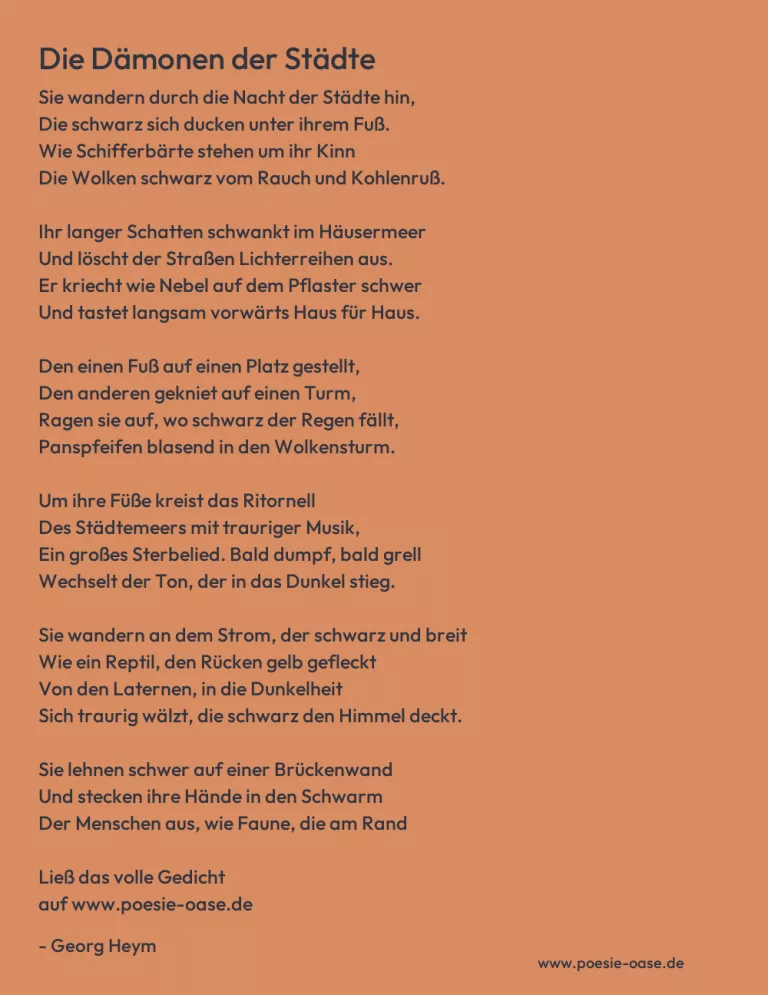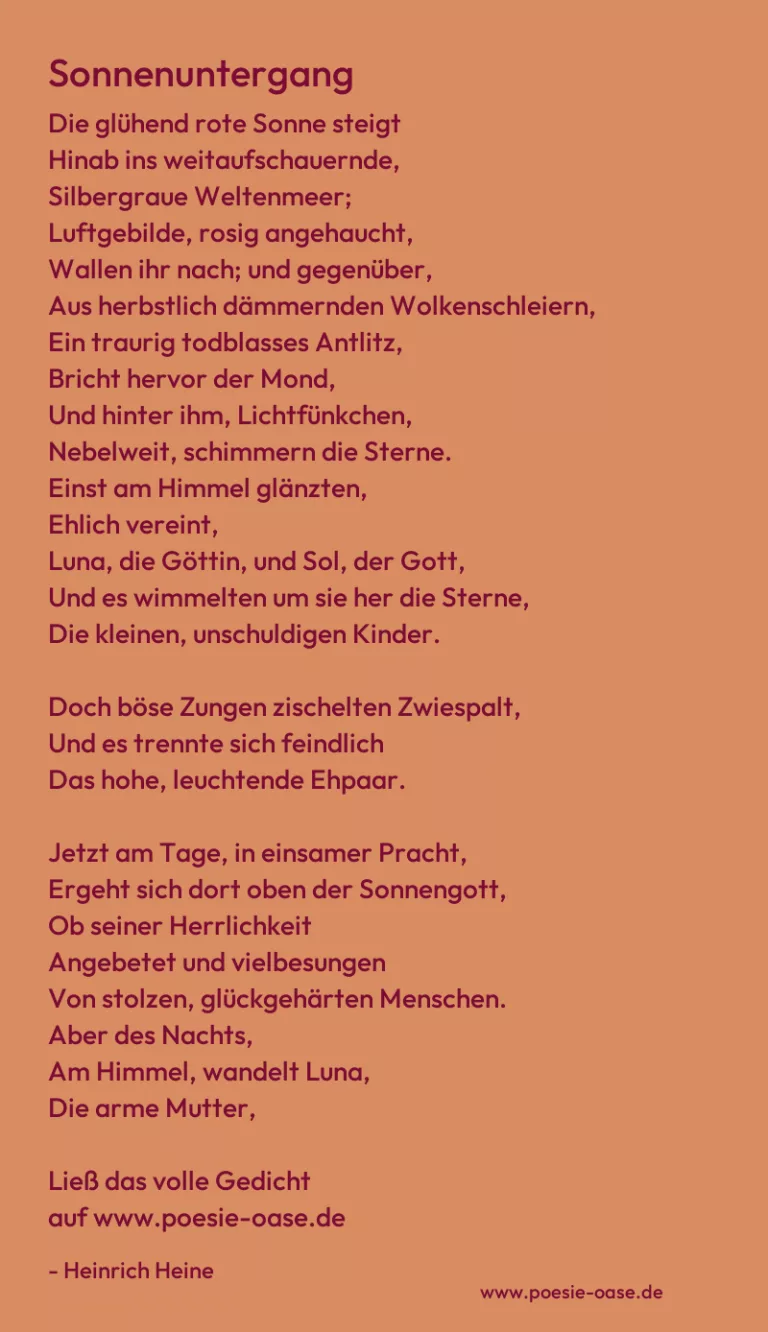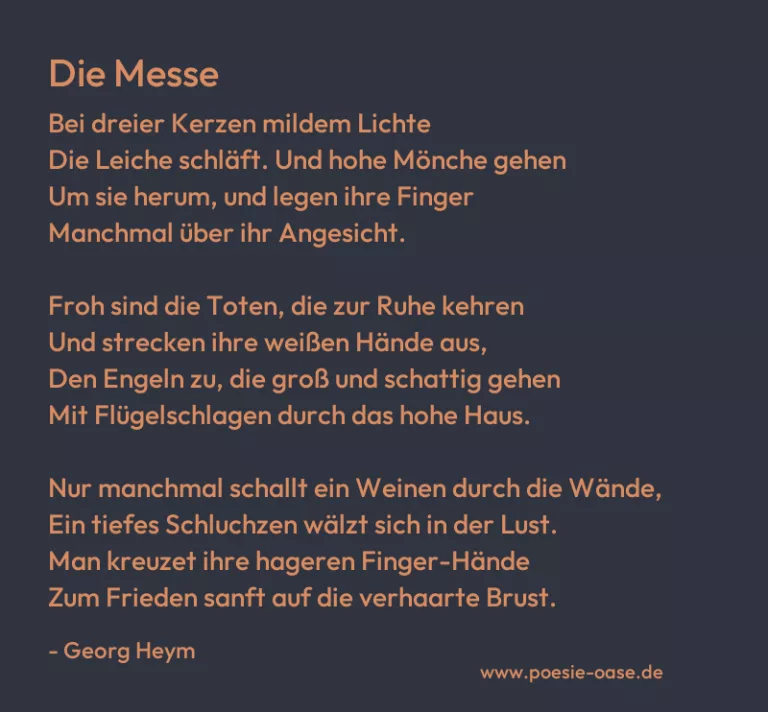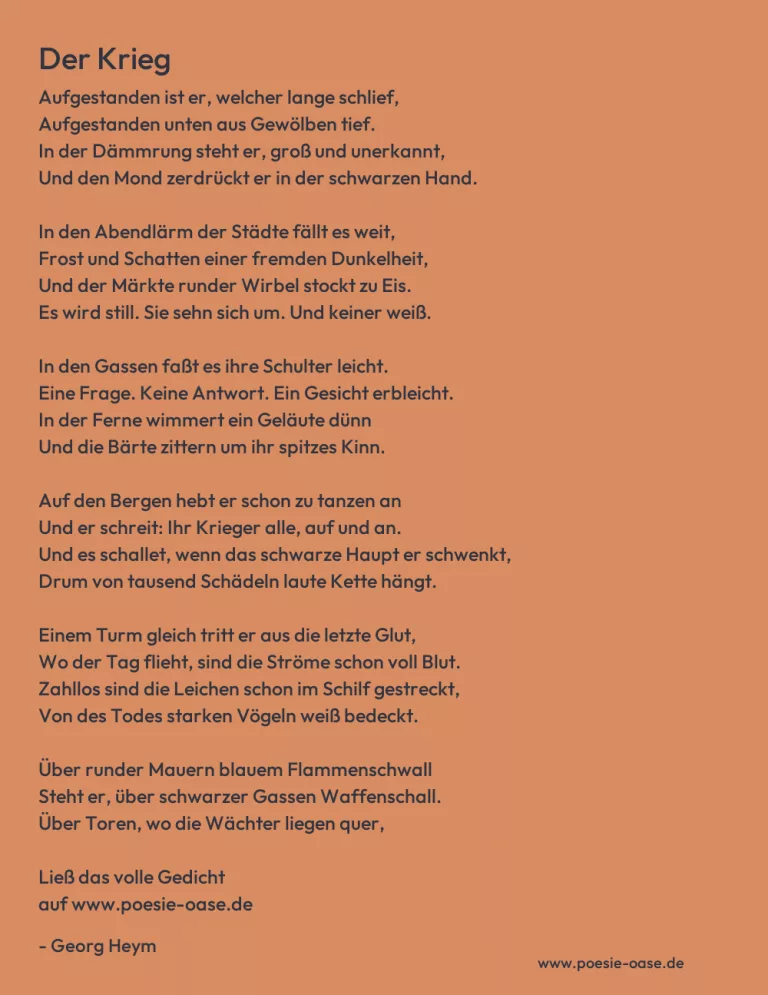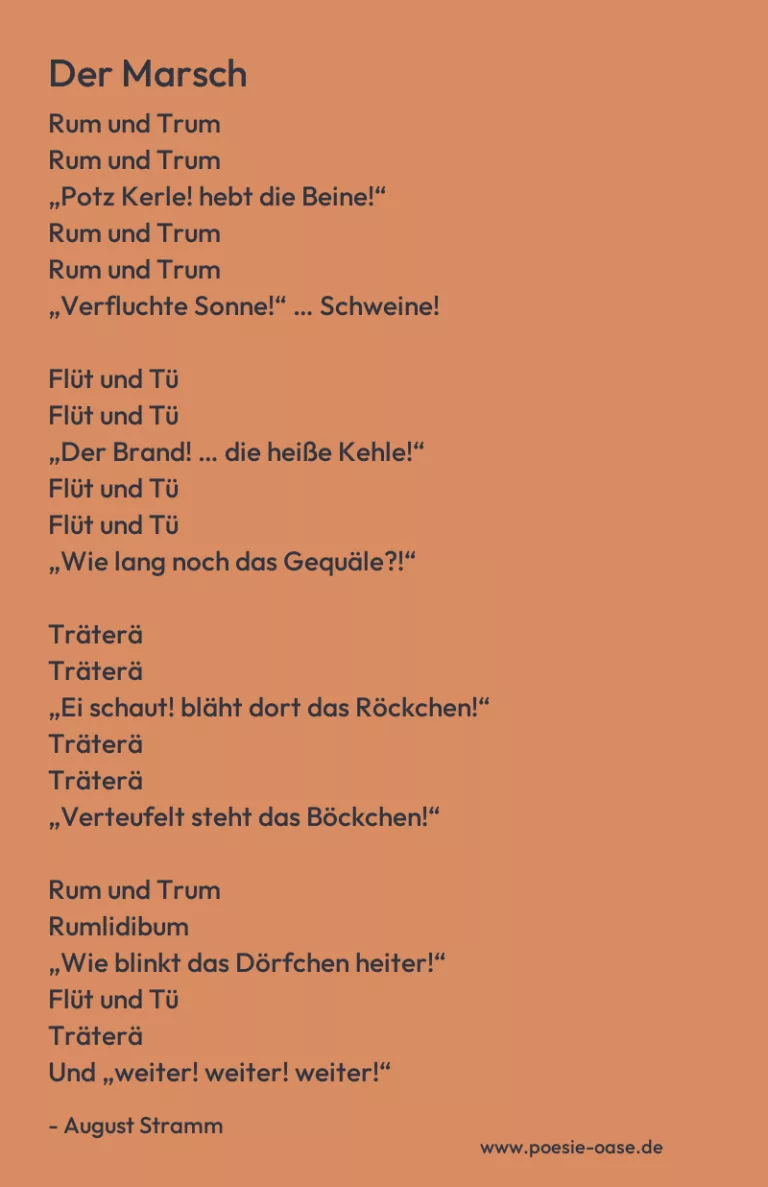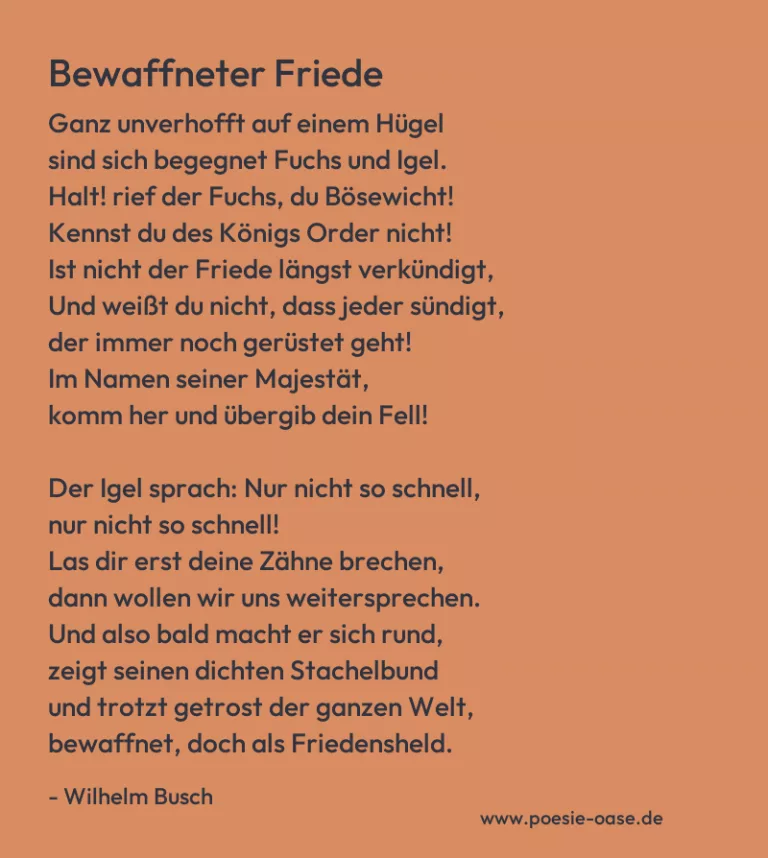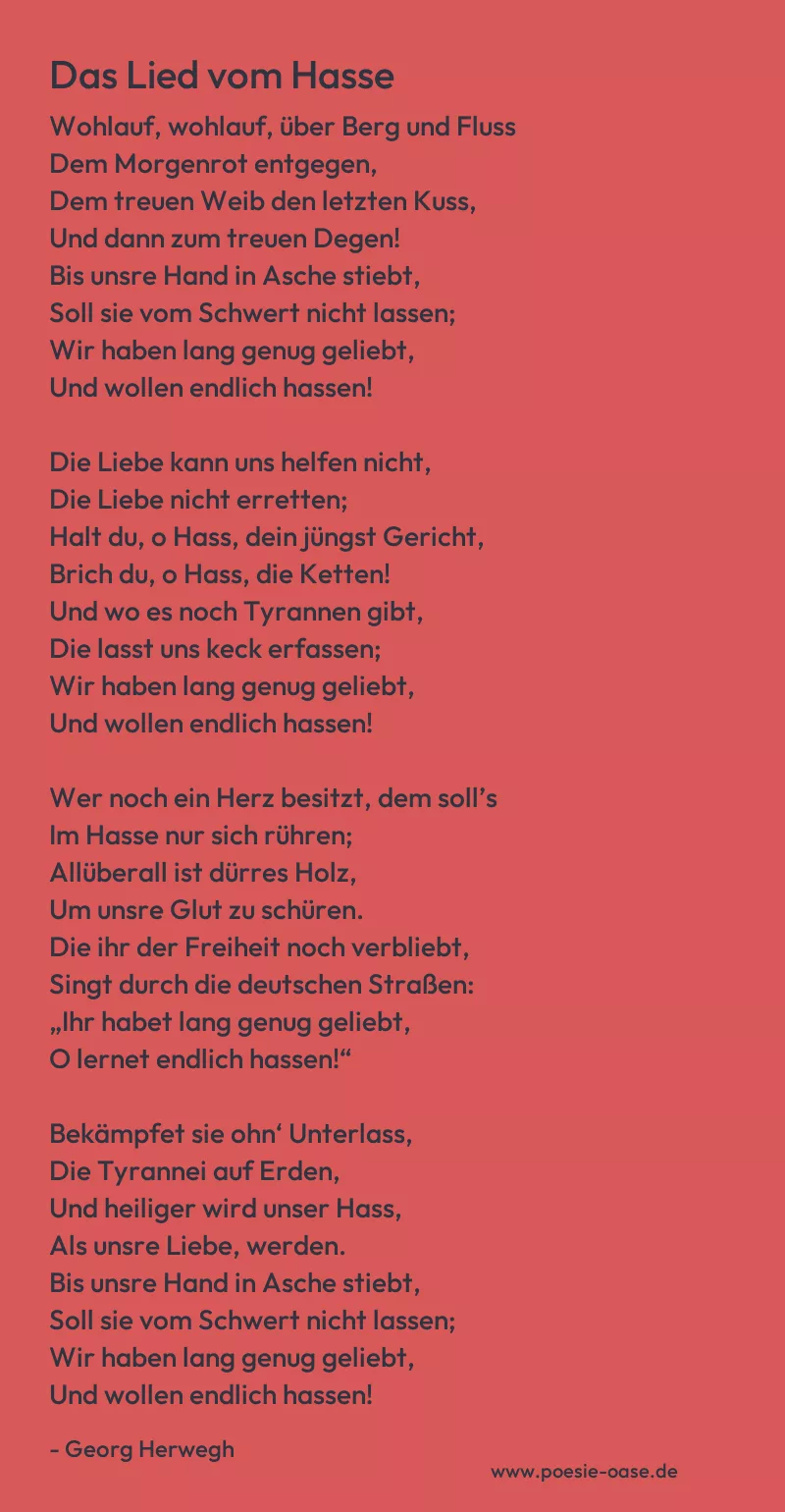Das Lied vom Hasse
Wohlauf, wohlauf, über Berg und Fluss
Dem Morgenrot entgegen,
Dem treuen Weib den letzten Kuss,
Und dann zum treuen Degen!
Bis unsre Hand in Asche stiebt,
Soll sie vom Schwert nicht lassen;
Wir haben lang genug geliebt,
Und wollen endlich hassen!
Die Liebe kann uns helfen nicht,
Die Liebe nicht erretten;
Halt du, o Hass, dein jüngst Gericht,
Brich du, o Hass, die Ketten!
Und wo es noch Tyrannen gibt,
Die lasst uns keck erfassen;
Wir haben lang genug geliebt,
Und wollen endlich hassen!
Wer noch ein Herz besitzt, dem soll’s
Im Hasse nur sich rühren;
Allüberall ist dürres Holz,
Um unsre Glut zu schüren.
Die ihr der Freiheit noch verbliebt,
Singt durch die deutschen Straßen:
„Ihr habet lang genug geliebt,
O lernet endlich hassen!“
Bekämpfet sie ohn‘ Unterlass,
Die Tyrannei auf Erden,
Und heiliger wird unser Hass,
Als unsre Liebe, werden.
Bis unsre Hand in Asche stiebt,
Soll sie vom Schwert nicht lassen;
Wir haben lang genug geliebt,
Und wollen endlich hassen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
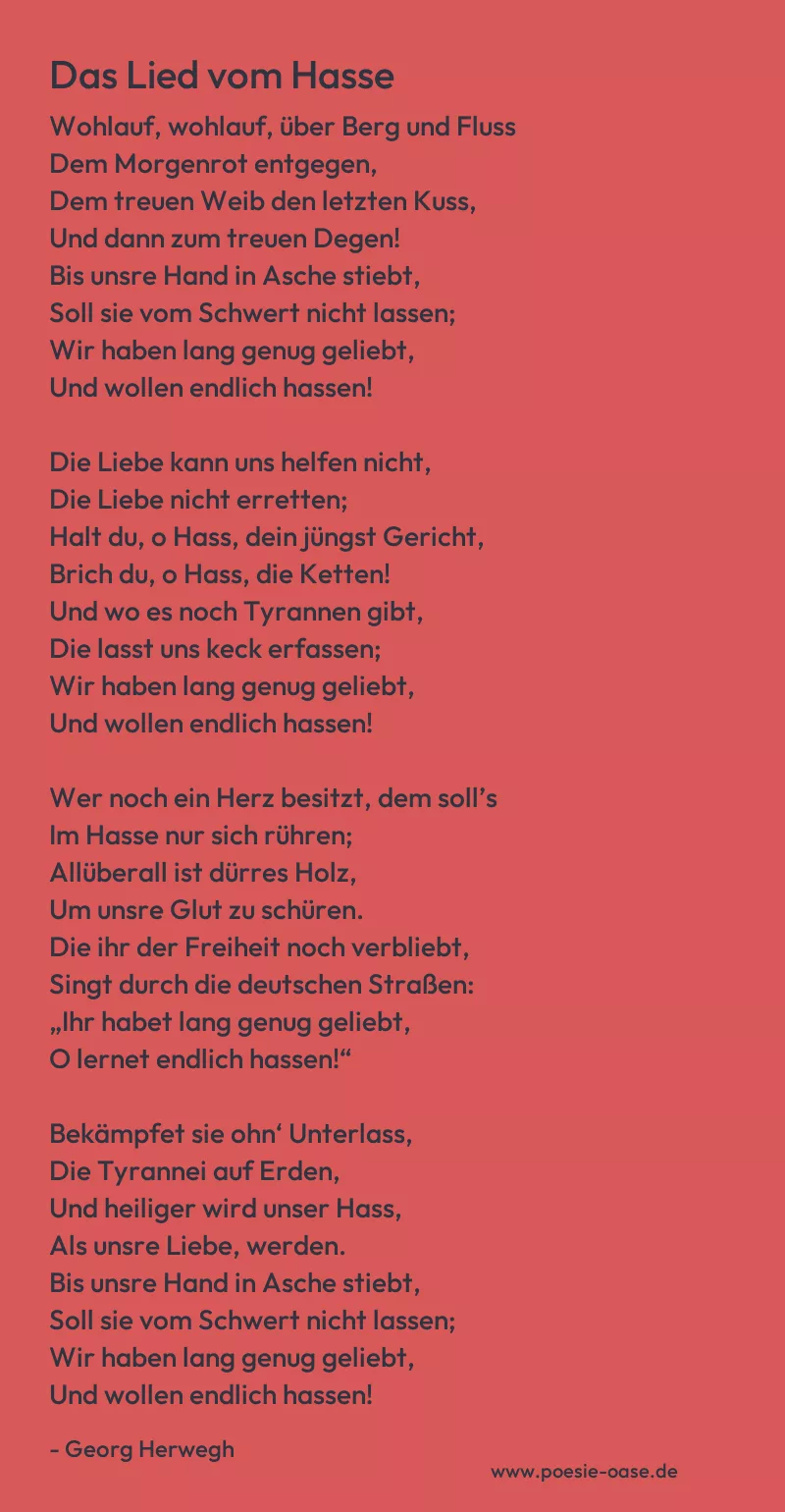
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Lied vom Hasse“ von Georg Herwegh ist ein leidenschaftlicher Aufruf zu revolutionärer Aktion und ein Bekenntnis zu einer form von Hass gegen Unterdrückung und Tyrannei. Die Eröffnung des Gedichts zeigt eine entschlossene Bewegung „über Berg und Fluss“ und den Abschied von der „treuen Weib“, was sowohl eine physische als auch symbolische Reise in die Freiheit darstellt. Der „letzte Kuss“ an die Frau steht für den endgültigen Abschied von der Vergangenheit, während der „treue Degen“ das Symbol des Widerstandes gegen die Tyrannei ist. Die Aussage „Wir haben lang genug geliebt, und wollen endlich hassen!“ drückt die Frustration über verpasste Chancen und den Entschluss aus, nun aktiv gegen die Unterdrückung vorzugehen.
Im zweiten Teil des Gedichts wird die Liebe als ineffektiv und unzureichend im Kampf gegen Tyrannei und Ungerechtigkeit betrachtet. Der Aufruf richtet sich an den „Hass“, der nun das „jüngste Gericht“ vollziehen soll. Hass wird hier als die notwendige Kraft und die einzige Möglichkeit dargestellt, die „Ketten“ der Unterdrückung zu sprengen. Dieser Wandel von der Liebe zum Hass symbolisiert eine Wendung hin zu einer härteren Haltung, die die Notwendigkeit des Widerstands betont. Der Hass wird als heiliger und reinigender Akt beschrieben, der zu einer radikalen Veränderung führen soll.
Die dritte Strophe vertieft diese Vorstellung und fordert eine Vereinigung der Menschen, die noch „der Freiheit verblieben“ sind, zum Handeln. Der Aufruf, in den „deutschen Straßen“ zu singen, verstärkt das kollektive Element des Widerstandes. Das Bild von „dürrem Holz“ und „Glut“ zeigt die Zerstörungskraft, die durch die Vereinigung der Freiheitsliebenden entfacht werden kann. Der Aufruf an das Volk, „endlich zu hassen“, verstärkt die Idee, dass der passive Zustand der Liebe und des Friedens in der Situation der Unterdrückung nicht länger tragbar ist – stattdessen wird zu einem entschlossenen und aktiven Widerstand aufgerufen.
In der letzten Strophe wird die Zielsetzung des Gedichts noch klarer: Die Bekämpfung der „Tyrannei auf Erden“ soll ohne Unterlass erfolgen, und der „Hass“ wird zum heiligerem Ziel als die Liebe, da er als notwendiges Mittel im Kampf gegen die Unterdrückung angesehen wird. Der „Schwert“ als Symbol für den Widerstand und die „Asche“ als Endpunkt dieses Kampfes unterstreichen die Intensität des Aufrufs und die Bereitschaft, bis zum Ende zu kämpfen. Das Gedicht endet mit der gleichen Aussage wie zu Beginn: „Wir haben lang genug geliebt, und wollen endlich hassen!“, was die Unnachgiebigkeit und Entschlossenheit des Sprechers verdeutlicht.
Insgesamt ist das Gedicht ein dramatischer Aufruf zur Revolution und zur Ablehnung der passiven Liebe zugunsten einer aktiven, kämpferischen Haltung des Hasses, der als notwendiges Werkzeug im Kampf gegen die Tyrannei angesehen wird. Es fordert die Menschen zu einem radikalen Wandel in ihrer Denkweise und zu einem entschlossenen Widerstand auf.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.