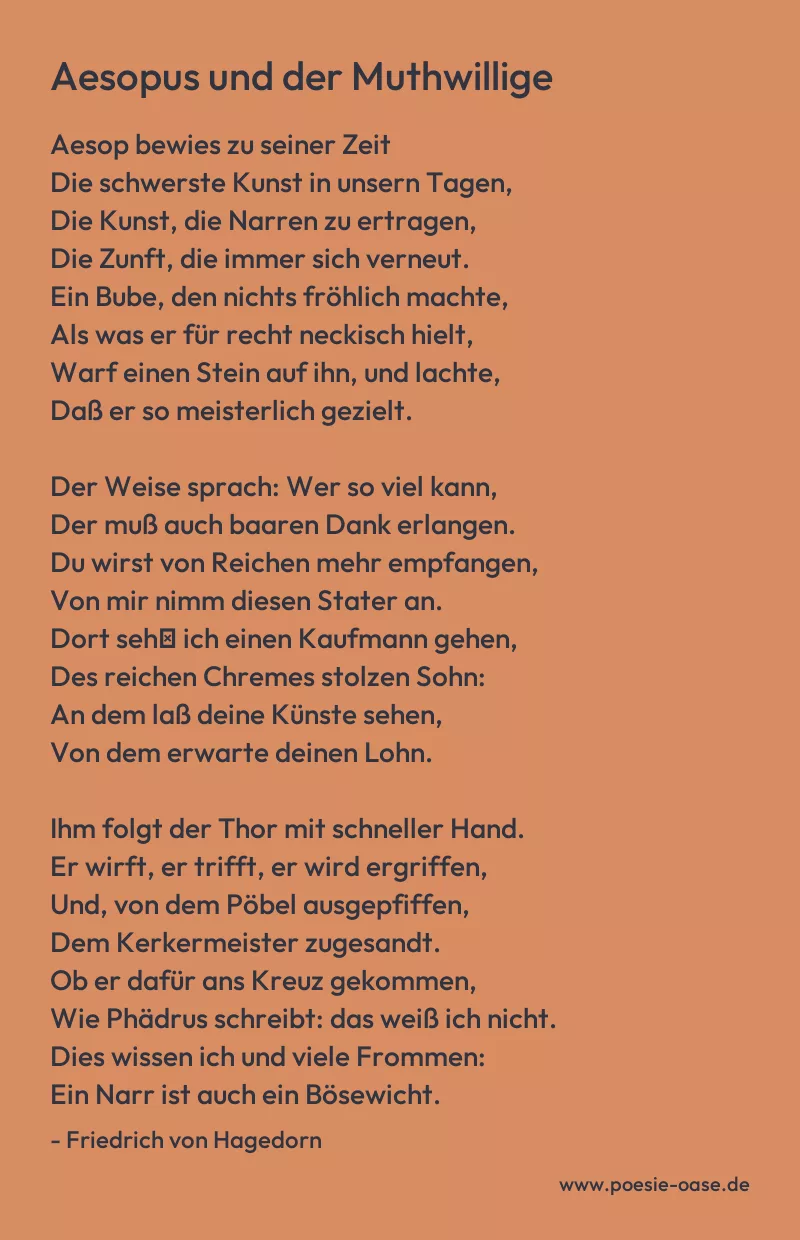Aesopus und der Muthwillige
Aesop bewies zu seiner Zeit
Die schwerste Kunst in unsern Tagen,
Die Kunst, die Narren zu ertragen,
Die Zunft, die immer sich verneut.
Ein Bube, den nichts fröhlich machte,
Als was er für recht neckisch hielt,
Warf einen Stein auf ihn, und lachte,
Daß er so meisterlich gezielt.
Der Weise sprach: Wer so viel kann,
Der muß auch baaren Dank erlangen.
Du wirst von Reichen mehr empfangen,
Von mir nimm diesen Stater an.
Dort seh′ ich einen Kaufmann gehen,
Des reichen Chremes stolzen Sohn:
An dem laß deine Künste sehen,
Von dem erwarte deinen Lohn.
Ihm folgt der Thor mit schneller Hand.
Er wirft, er trifft, er wird ergriffen,
Und, von dem Pöbel ausgepfiffen,
Dem Kerkermeister zugesandt.
Ob er dafür ans Kreuz gekommen,
Wie Phädrus schreibt: das weiß ich nicht.
Dies wissen ich und viele Frommen:
Ein Narr ist auch ein Bösewicht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
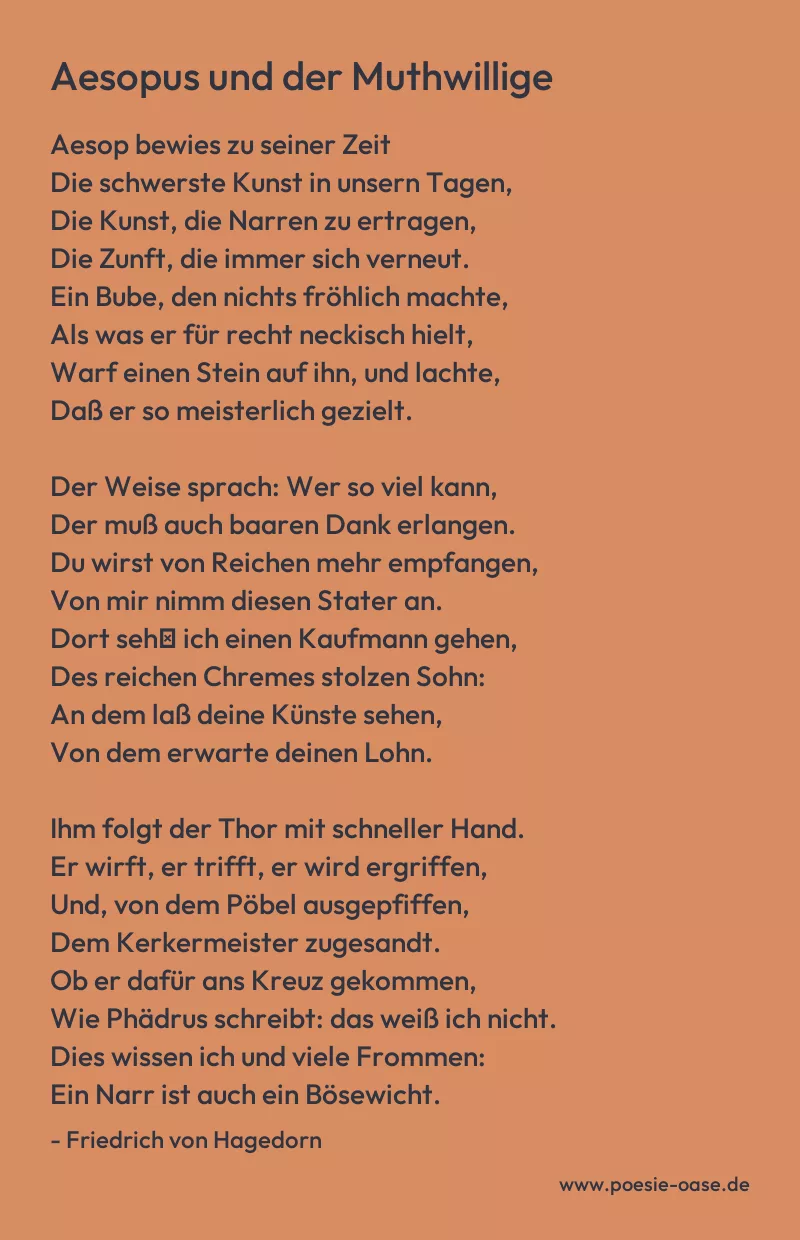
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Aesopus und der Muthwillige“ von Friedrich von Hagedorn ist eine didaktische Fabel, die sich mit der Thematik des Umgangs mit Narren und der Vergeltung von Ungerechtigkeit auseinandersetzt. Die Geschichte umreißt einen Vorfall, in dem der weise Aesop von einem ungestümen Buben mit einem Stein beworfen wird. Aesop reagiert jedoch nicht mit Zorn oder Rache, sondern mit einer ungewöhnlichen Geste der Großzügigkeit und der indirekten Strafe.
Die Interpretation des Gedichts offenbart eine tiefere Bedeutungsebene. Aesops Reaktion, dem Buben einen „Stater“ (eine Münze) zu schenken und ihn auf einen reichen Kaufmann, den Sohn von Chremes, zu verweisen, ist nicht nur ein Akt der scheinbaren Nachgiebigkeit, sondern eine List. Er erkennt die Natur des Narren, der sich einzig durch Streiche und Schadenfreude erfreut, und lenkt dessen zerstörerische Energie in eine Richtung, die ihn selbst ins Verderben stürzt. Der Narr, anstatt seinen Spaß zu haben, begeht einen weiteren, folgenschwereren Übergriff, der ihn ins Gefängnis und möglicherweise sogar zum Tod am Kreuz führt.
Die Sprache des Gedichts ist klar und prägnant, typisch für die Epoche der Aufklärung, in der Hagedorn lebte. Die Verwendung von direkter Rede und die kurze, prägnante Erzählweise verstärken die didaktische Absicht des Autors. Durch die scheinbar einfache Geschichte wird eine komplexe Moral vermittelt: Die Kunst, Narren zu ertragen, bedeutet nicht, sich ihrer Willkür zu beugen, sondern sie mit Klugheit und List zu bekämpfen. Die Fabel unterstreicht die Erkenntnis, dass Narren oft ihre eigenen Feinde sind und dass ihre Handlungen sie selbst ins Verderben stürzen können.
Das Gedicht wirft auch ein Licht auf die soziale Ordnung der Zeit. Der reiche Kaufmann steht für die Privilegierten, während der Narr für diejenigen steht, die sich außerhalb der sozialen Normen bewegen und durch ihr Verhalten Schaden anrichten. Aesops Reaktion auf den Angriff des Narren spiegelt eine Strategie der indirekten Vergeltung wider, die auf die gesellschaftliche Struktur zugeschnitten ist. Die Fabel verdeutlicht somit, dass Klugheit und Weitsicht im Umgang mit Ungerechtigkeit und Torheit von größerer Bedeutung sind als unmittelbare Rache. Die abschließende Aussage, dass „Ein Narr ist auch ein Bösewicht“, unterstreicht die moralische Wertung des Gedichts und die Warnung vor den Gefahren des Narrentums.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.