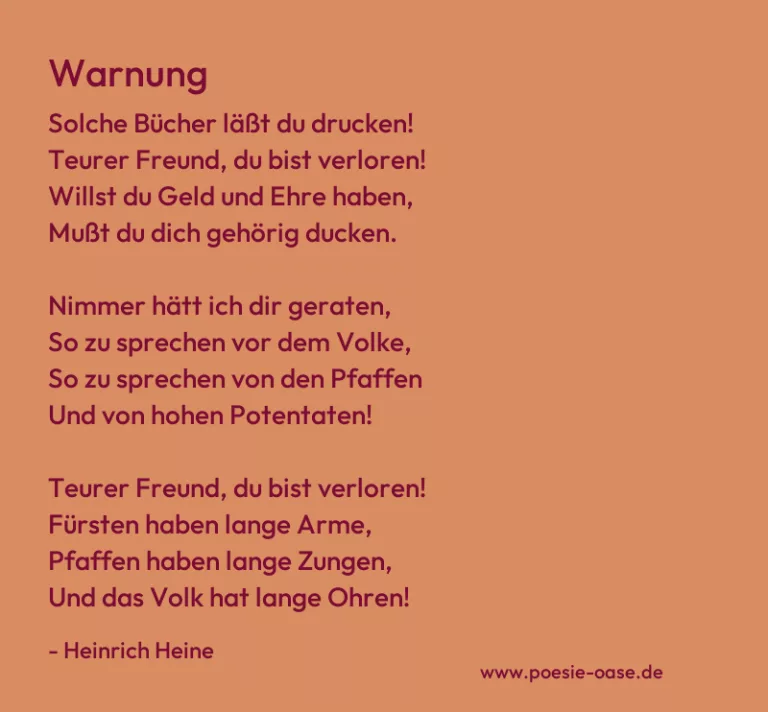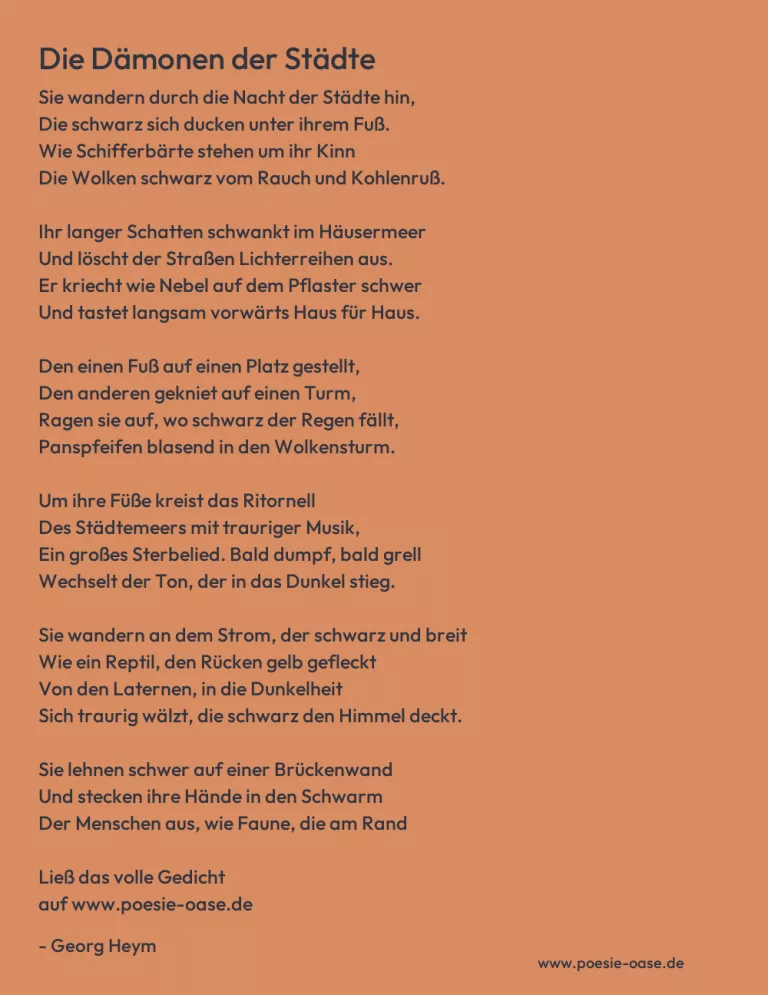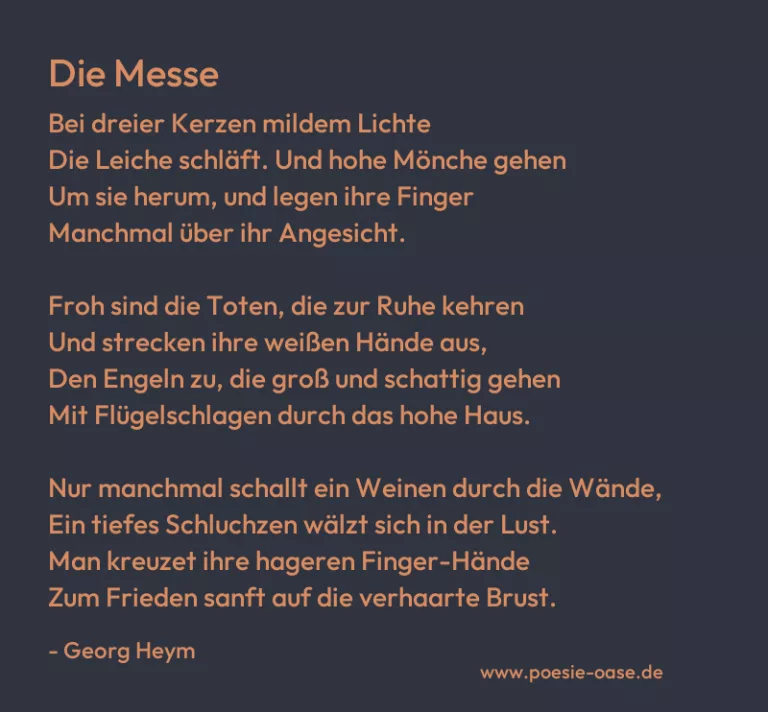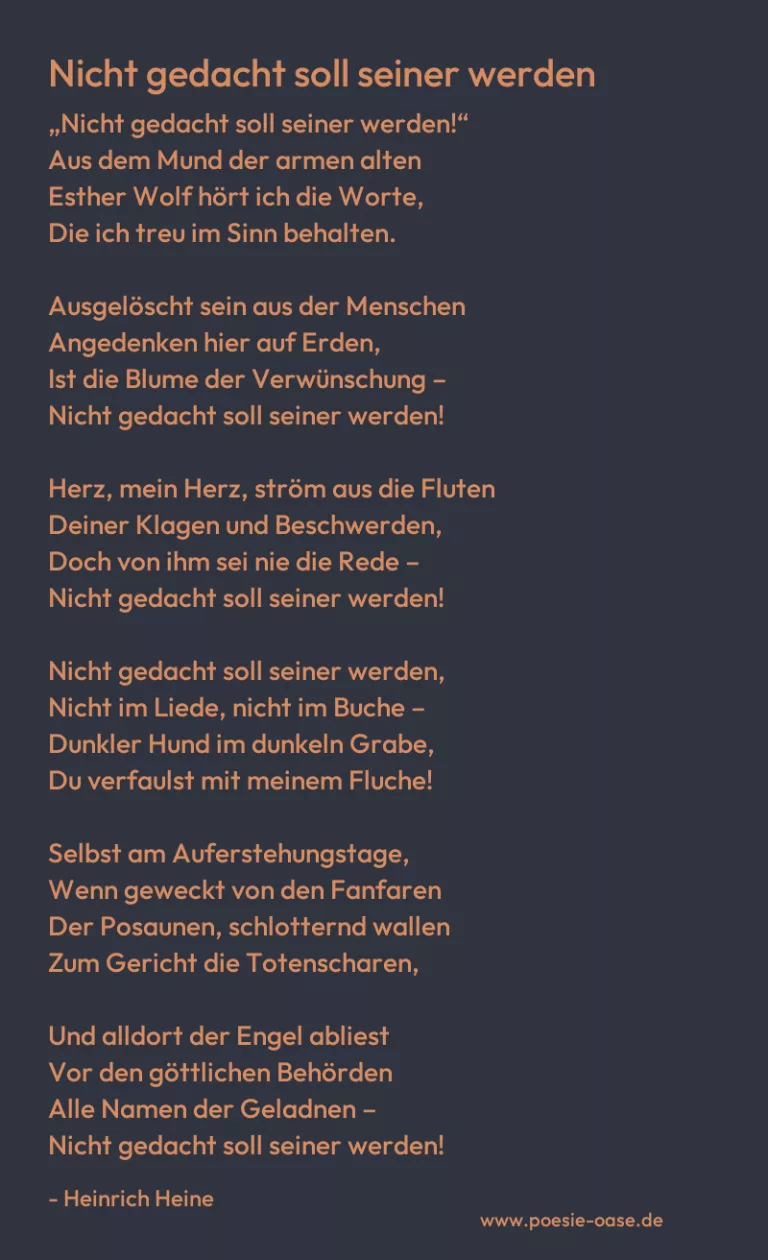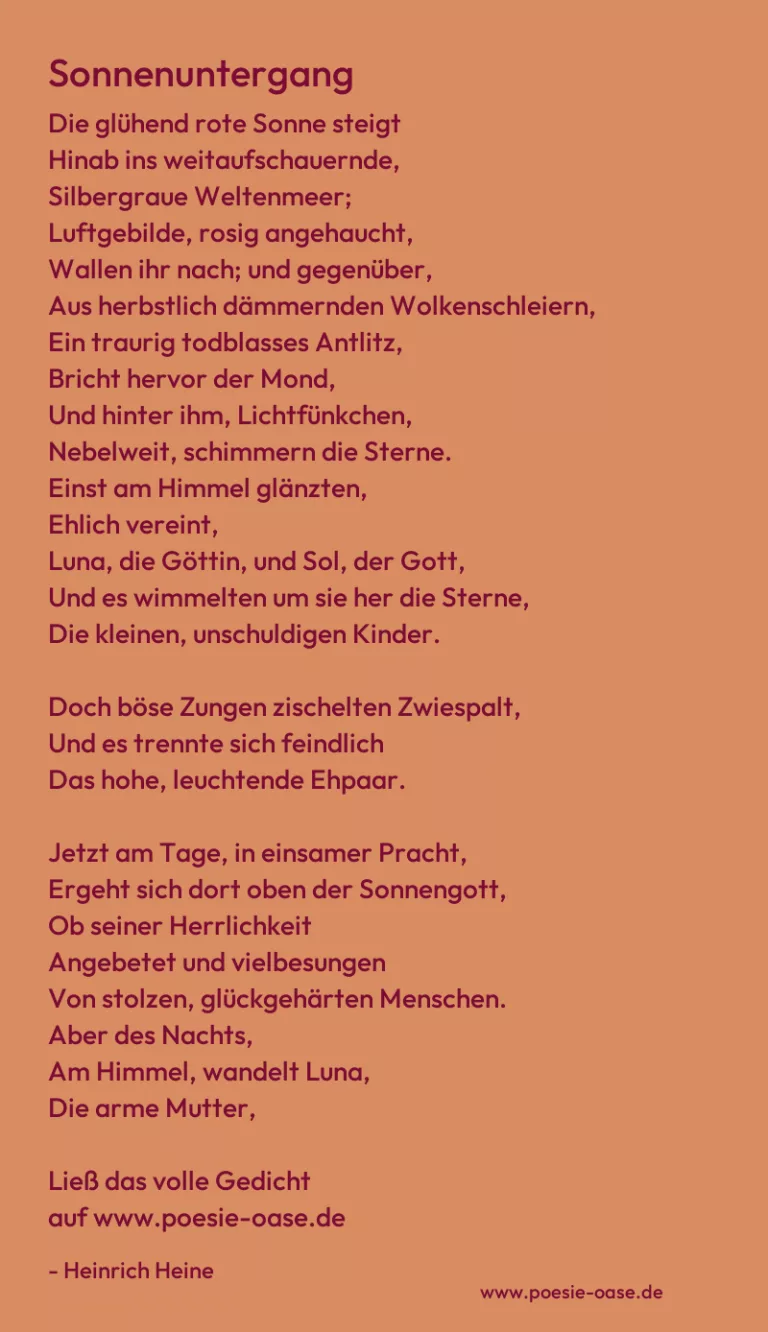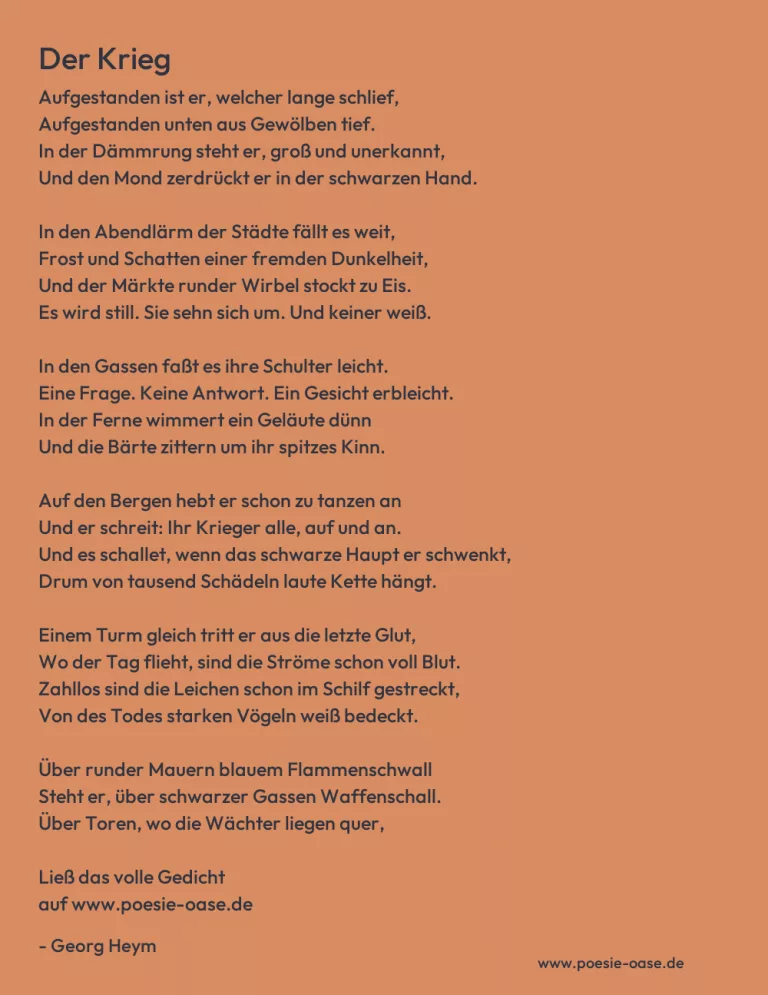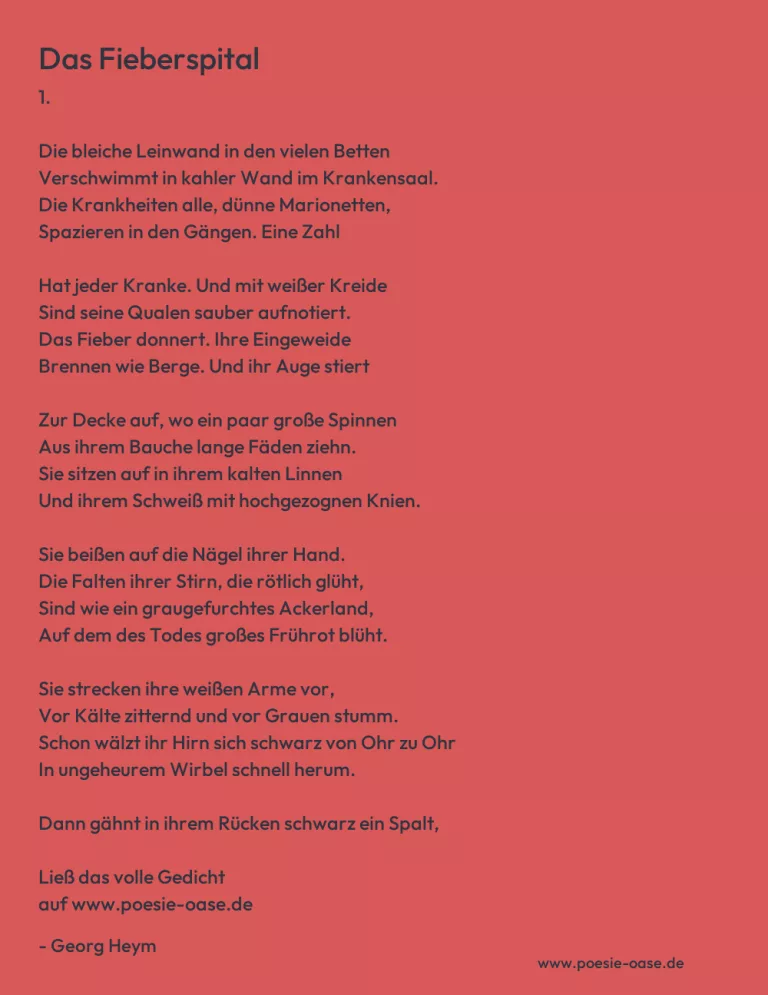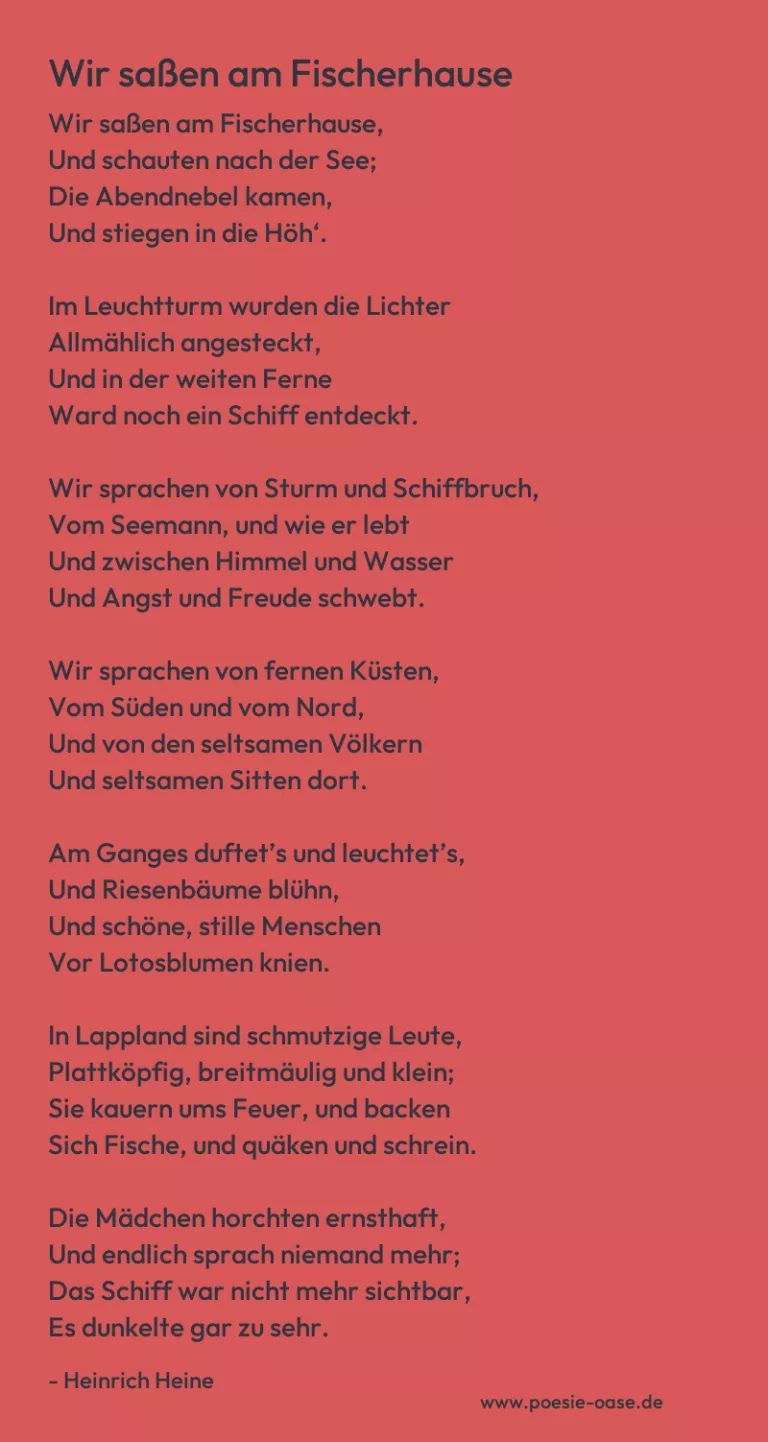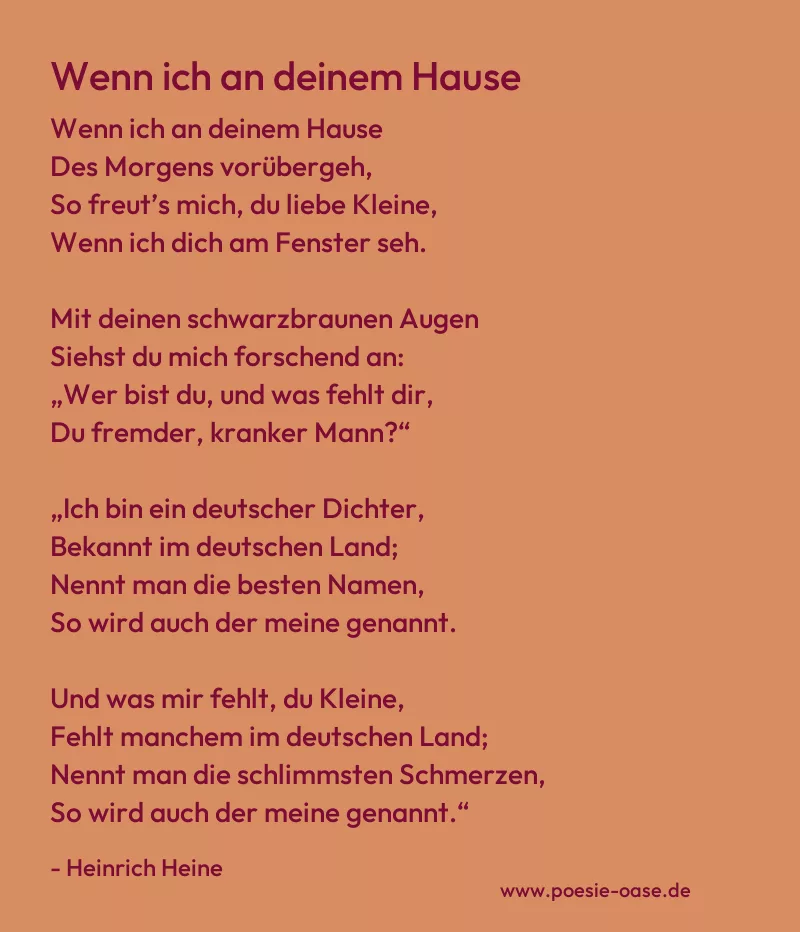Wenn ich an deinem Hause
Wenn ich an deinem Hause
Des Morgens vorübergeh,
So freut’s mich, du liebe Kleine,
Wenn ich dich am Fenster seh.
Mit deinen schwarzbraunen Augen
Siehst du mich forschend an:
„Wer bist du, und was fehlt dir,
Du fremder, kranker Mann?“
„Ich bin ein deutscher Dichter,
Bekannt im deutschen Land;
Nennt man die besten Namen,
So wird auch der meine genannt.
Und was mir fehlt, du Kleine,
Fehlt manchem im deutschen Land;
Nennt man die schlimmsten Schmerzen,
So wird auch der meine genannt.“
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
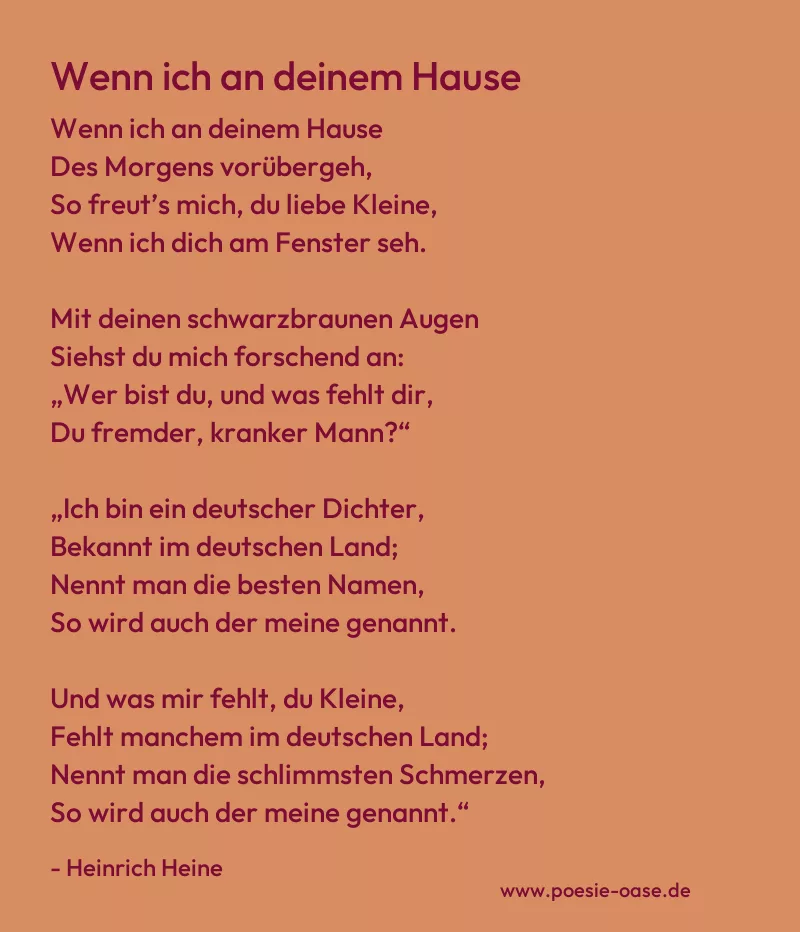
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wenn ich an deinem Hause“ von Heinrich Heine beschreibt eine kurze, aber intensive Begegnung zwischen dem lyrischen Ich und einer jungen Frau am Fenster. Die Szene wirkt zunächst harmlos und alltäglich: Ein Dichter geht morgens an einem Haus vorbei und freut sich über den Anblick der Frau. Doch schnell entwickelt sich das Gedicht in eine tiefere, melancholische Richtung, als das lyrische Ich die Aufmerksamkeit der Frau mit dem eigenen Leid und der Rolle als Dichter verknüpft.
Das Motiv des leidenden Künstlers steht im Zentrum. Der Sprecher bezeichnet sich selbst als „fremder, kranker Mann“ und führt dies auf sein Dasein als deutscher Dichter zurück. Dabei wird das Leiden nicht nur als individuelles, sondern auch als kollektives empfunden: „Fehlt manchem im deutschen Land.“ Die Verbindung zwischen Dichtung und Schmerz, Ruhm und innerer Zerrissenheit ist ein bekanntes Motiv der Romantik, das hier in Heines charakteristischer Mischung aus Selbstironie und Schwermut aufgegriffen wird.
Die Sprache des Gedichts ist einfach und direkt, fast volkstümlich. Durch den Wechsel zwischen der Beobachtung des Mädchens und der Selbstbeschreibung des Dichters entsteht eine subtile Spannung. Während die Frau nur als fragender Blick erscheint, nutzt das lyrische Ich die Szene, um sich selbst und sein Leiden darzustellen. Die schwarzbraunen Augen der Frau wirken dabei wie ein Spiegel, der die Isolation und Fremdheit des Dichters noch stärker hervortreten lässt.
Insgesamt handelt es sich um ein Gedicht, das in wenigen Strophen eine für Heine typische Mischung aus schlichter Alltagsszene und tiefer existenzieller Reflexion entfaltet. Die Begegnung bleibt oberflächlich, doch der Schmerz des lyrischen Ichs wird als universelles Schicksal des Künstlers und Menschen im „deutschen Land“ präsentiert – geprägt von Einsamkeit, Krankheit und der Melancholie des romantischen Geistes.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.