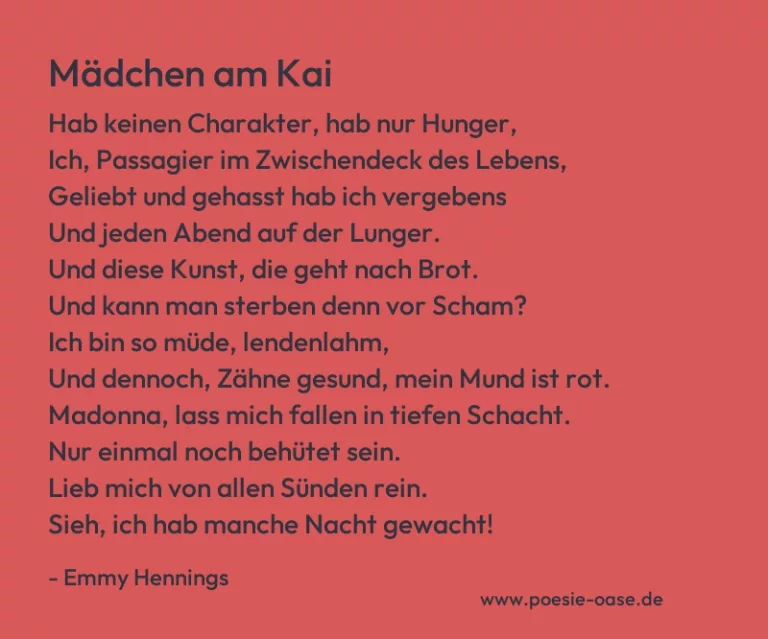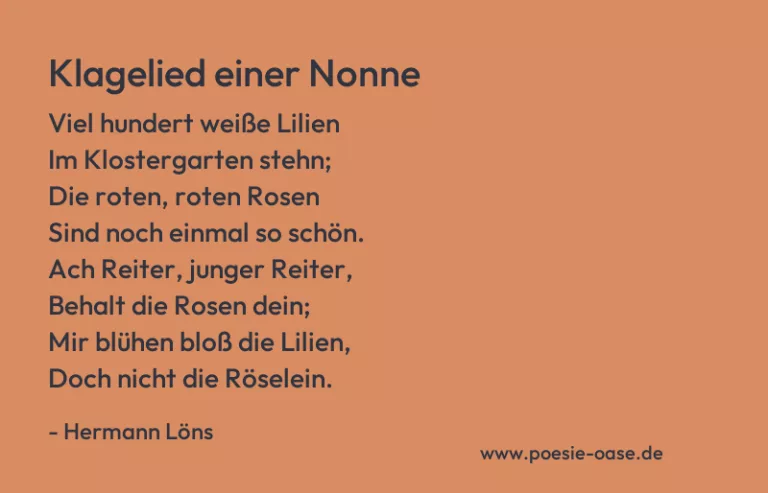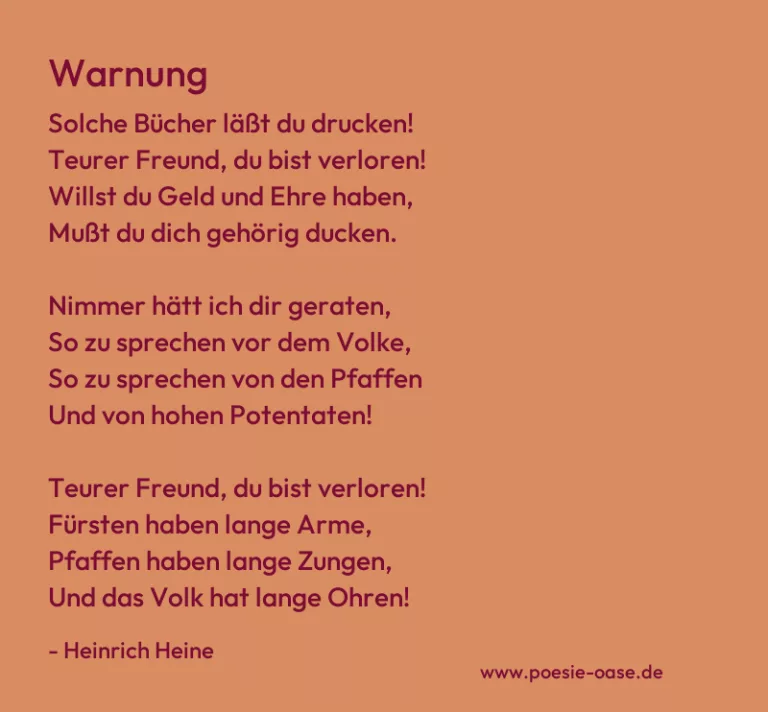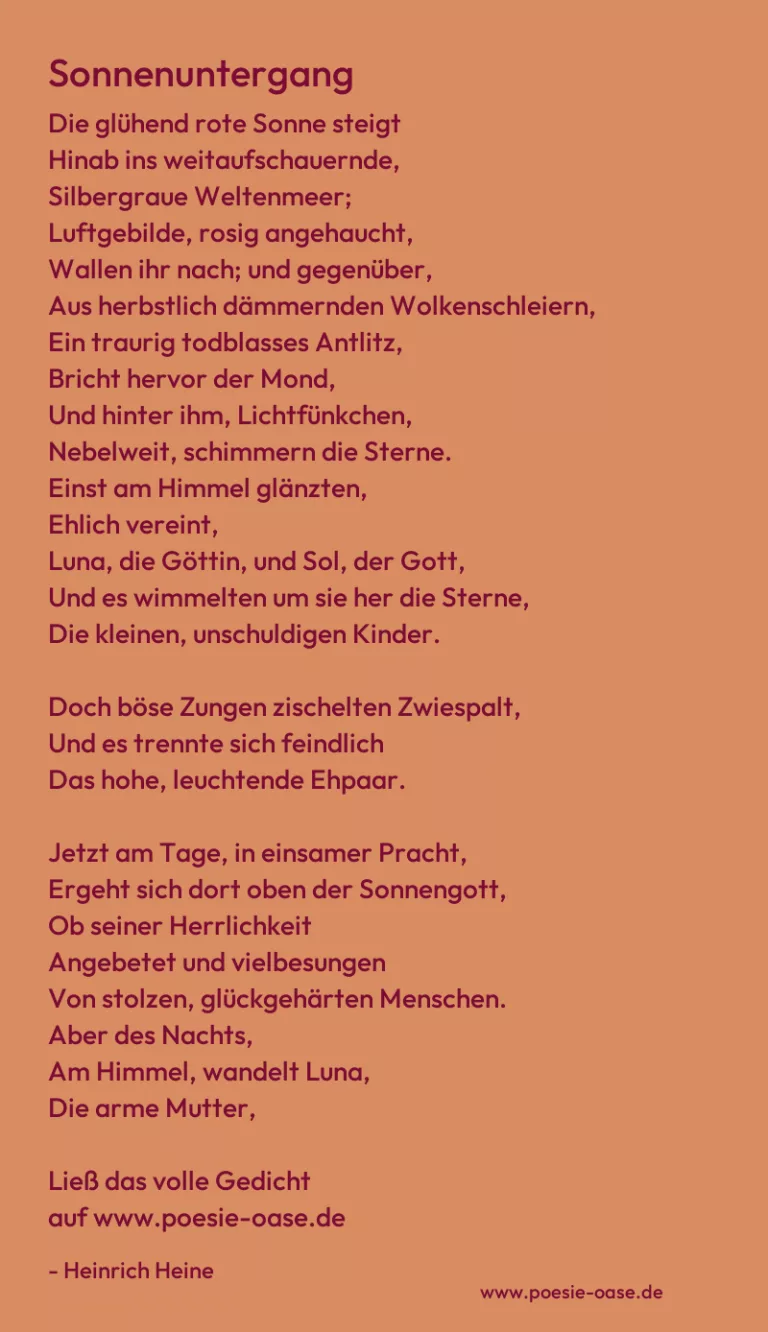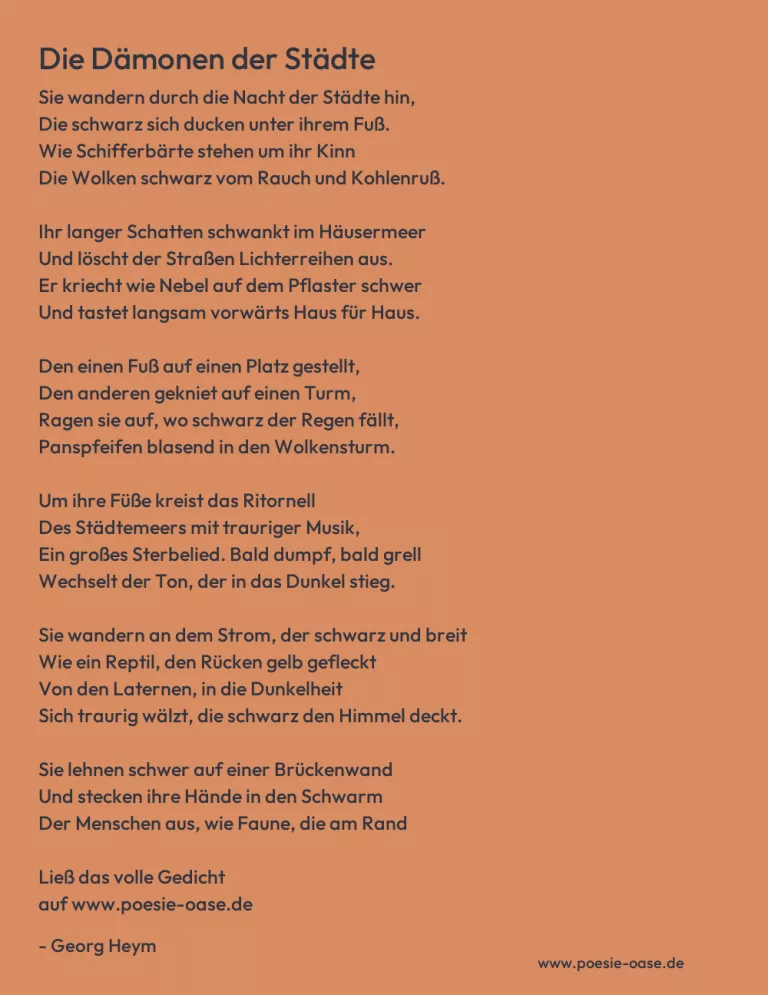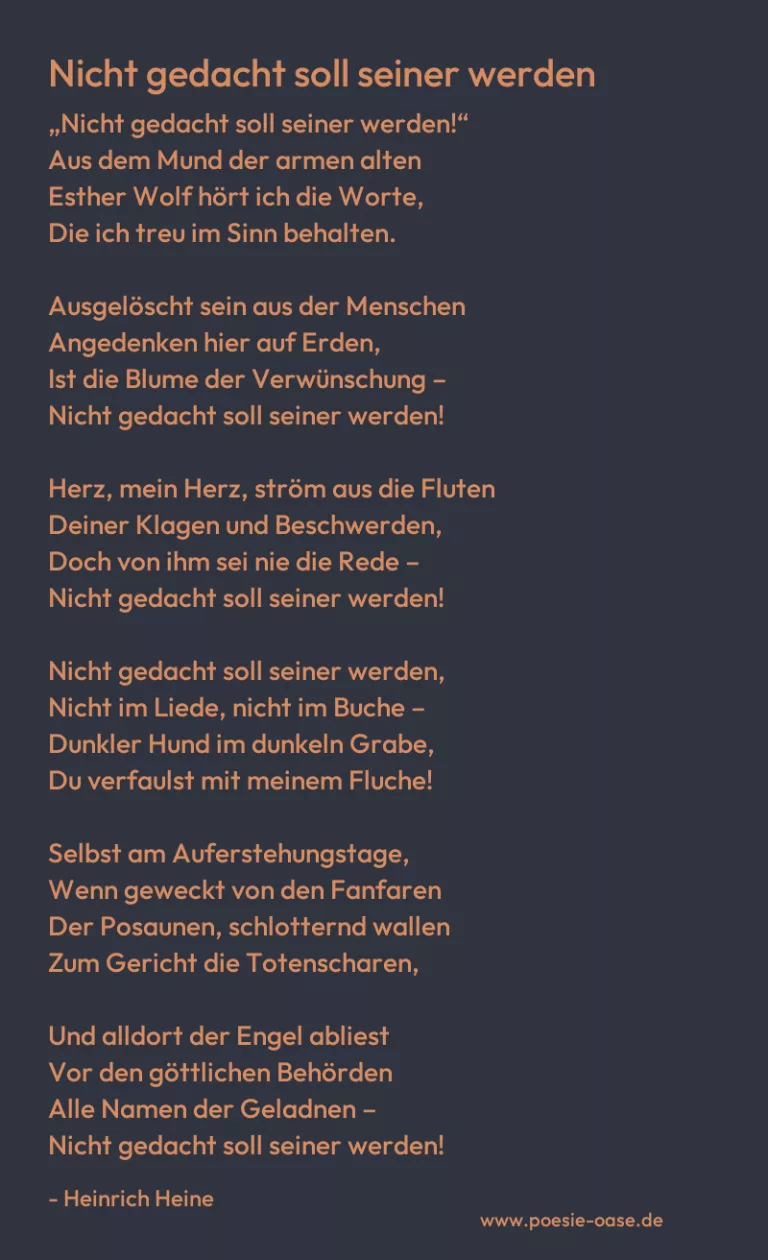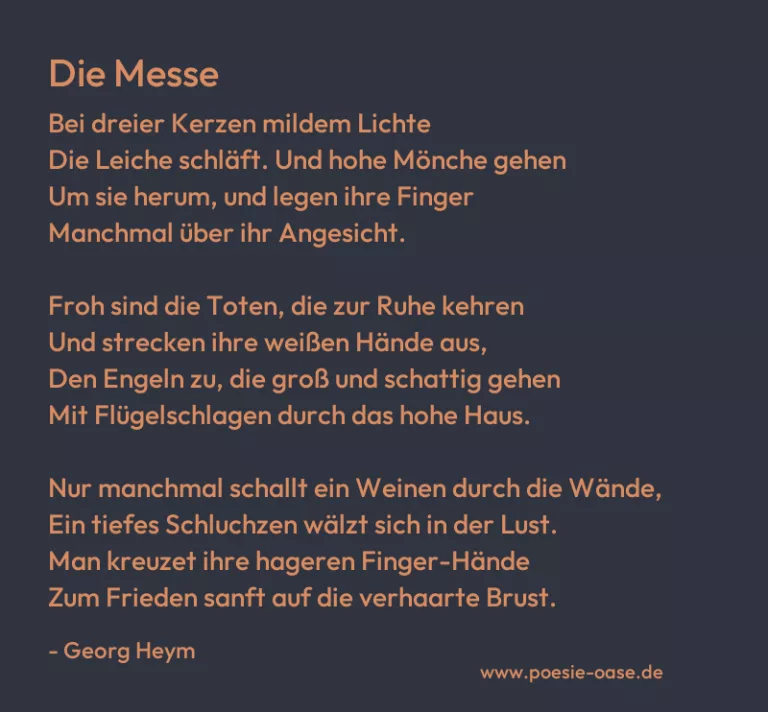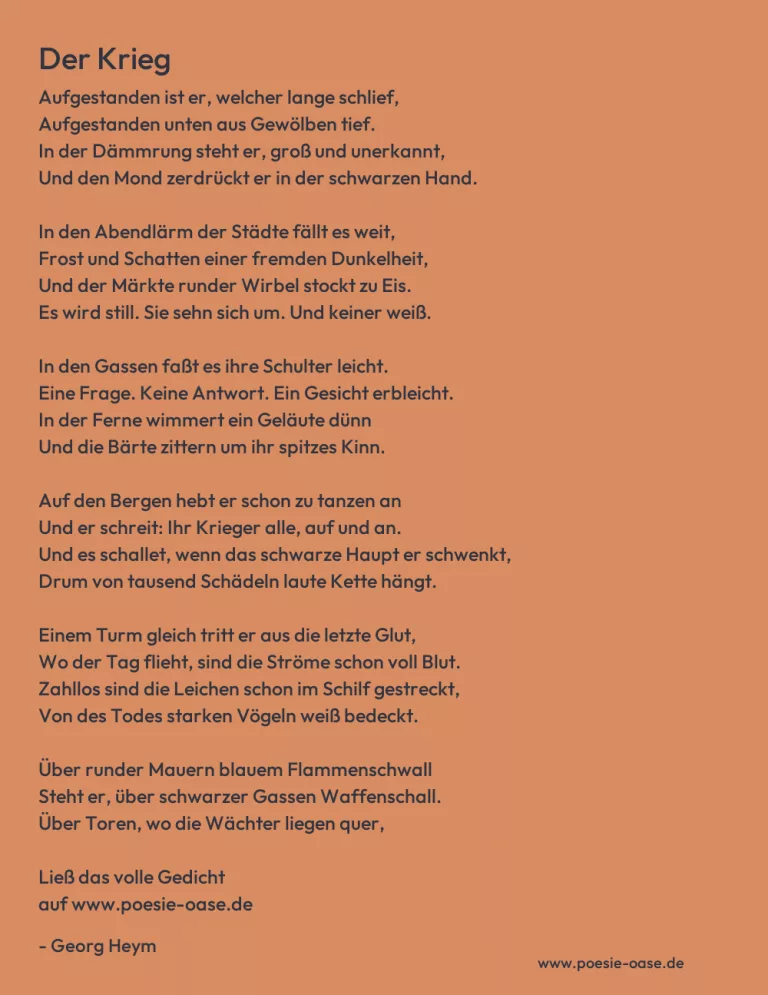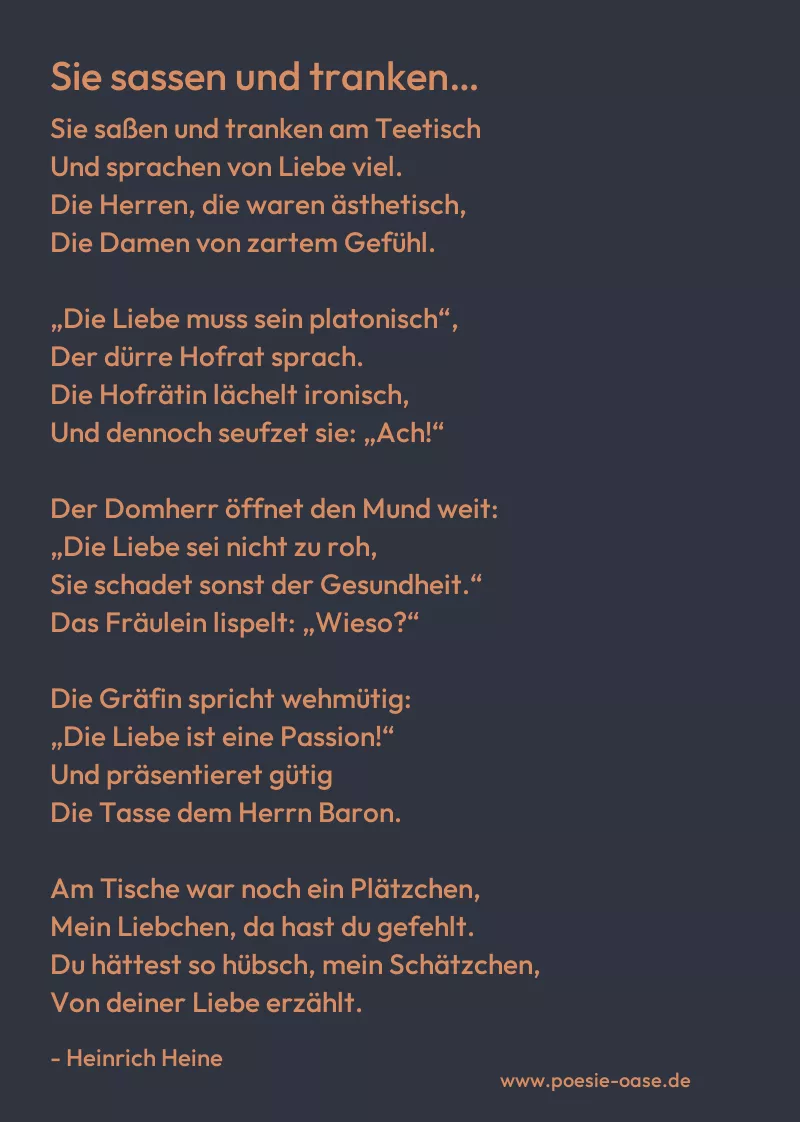Sie saßen und tranken am Teetisch
Und sprachen von Liebe viel.
Die Herren, die waren ästhetisch,
Die Damen von zartem Gefühl.
„Die Liebe muss sein platonisch“,
Der dürre Hofrat sprach.
Die Hofrätin lächelt ironisch,
Und dennoch seufzet sie: „Ach!“
Der Domherr öffnet den Mund weit:
„Die Liebe sei nicht zu roh,
Sie schadet sonst der Gesundheit.“
Das Fräulein lispelt: „Wieso?“
Die Gräfin spricht wehmütig:
„Die Liebe ist eine Passion!“
Und präsentieret gütig
Die Tasse dem Herrn Baron.
Am Tische war noch ein Plätzchen,
Mein Liebchen, da hast du gefehlt.
Du hättest so hübsch, mein Schätzchen,
Von deiner Liebe erzählt.