Schattenküsse, Schattenliebe,
Schattenleben, wunderbar!
Glaubst du, Närrin, alles bliebe
Unverändert, ewig wahr?
Was wir lieblich fest besessen,
Schwindet hin, wie Träumerein,
Und die Herzen, die vergessen,
Und die Augen schlafen ein.
Schattenküsse, Schattenliebe,
Schattenleben, wunderbar!
Glaubst du, Närrin, alles bliebe
Unverändert, ewig wahr?
Was wir lieblich fest besessen,
Schwindet hin, wie Träumerein,
Und die Herzen, die vergessen,
Und die Augen schlafen ein.
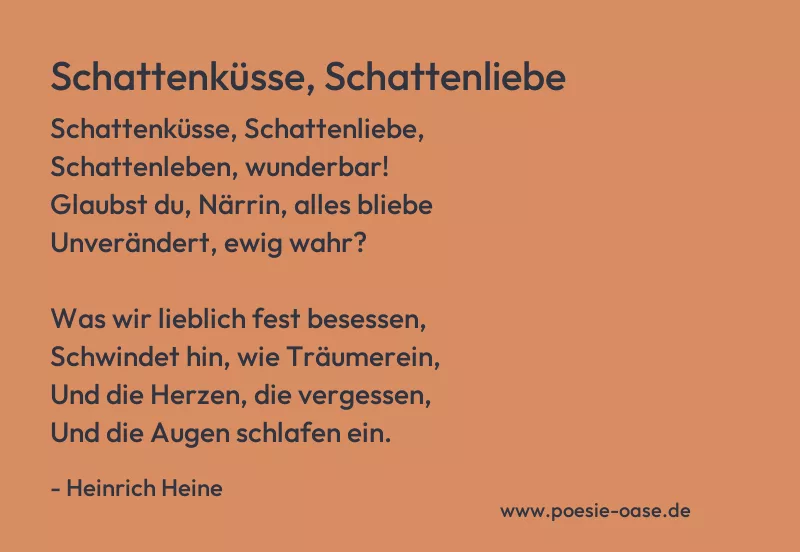
Das Gedicht „Schattenküsse, Schattenliebe“ von Heinrich Heine thematisiert die Vergänglichkeit von Liebe und Leben. Bereits der Titel deutet mit den Worten „Schattenküsse“ und „Schattenliebe“ auf etwas Unwirkliches, Flüchtiges hin. Die Liebe wird hier als Schatten beschrieben, als etwas, das zwar Spuren hinterlässt, aber nicht greifbar und von Dauer ist. Das lyrische Ich spricht eine Geliebte direkt an und stellt ihre naive Hoffnung auf Beständigkeit infrage.
Heine greift dabei die romantische Vorstellung von Liebe als ewigem, unvergänglichem Gefühl auf, nur um sie im gleichen Atemzug zu entzaubern. Die „Närrin“ glaubt, alles bleibe „unverändert, ewig wahr“, doch das lyrische Ich widerspricht und verweist darauf, dass das, was einst fest und schön erschien, so vergänglich ist wie ein Traum. Liebe, Besitz und emotionale Sicherheit sind laut Heine nur Illusionen, die unweigerlich verschwinden.
In der zweiten Strophe wird dieser Gedanke noch verstärkt. Die Bilder des „Schwindens“ und des „Vergessens“ prägen den Ton. Heine beschreibt, wie das Liebesglück in die Sphäre des Vergänglichen übergeht: die Herzen vergessen, die Augen schlafen ein. Die Metaphern verweisen nicht nur auf das Verblassen der Liebe, sondern auch auf den Kreislauf von Erinnern und Vergessen, von Wachen und Einschlafen – ein Symbol für das menschliche Leben selbst.
Das Gedicht zeichnet so ein Bild von Liebe als temporärem Glücksmoment, der sich der Kontrolle entzieht. Heine entlarvt romantische Illusionen und betont mit schlichter, aber wirkungsvoller Sprache die Unausweichlichkeit von Vergänglichkeit – in der Liebe wie im Leben.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.