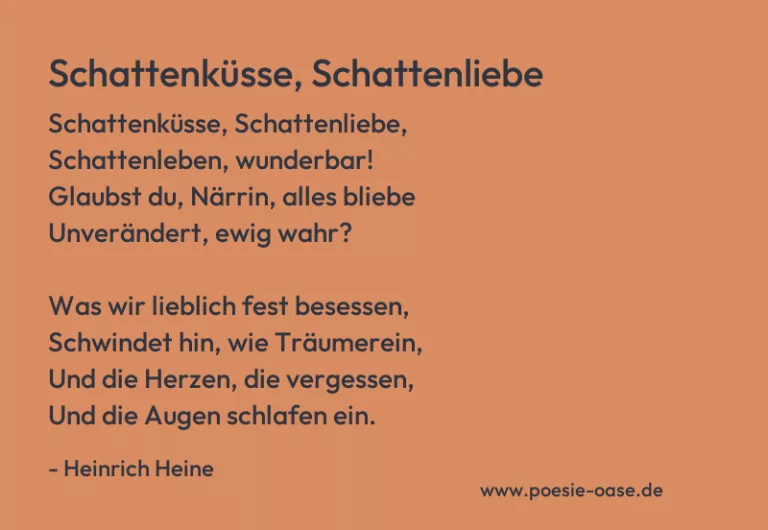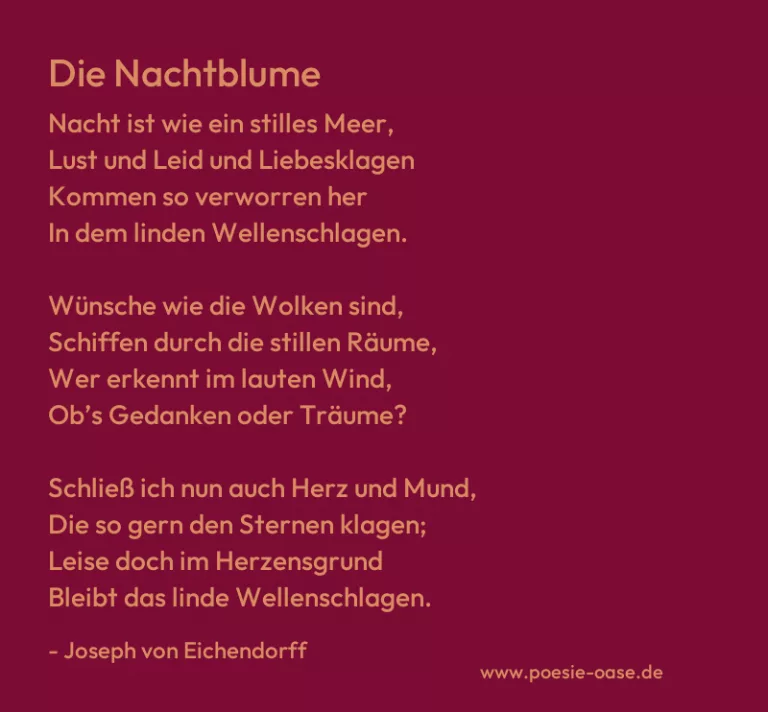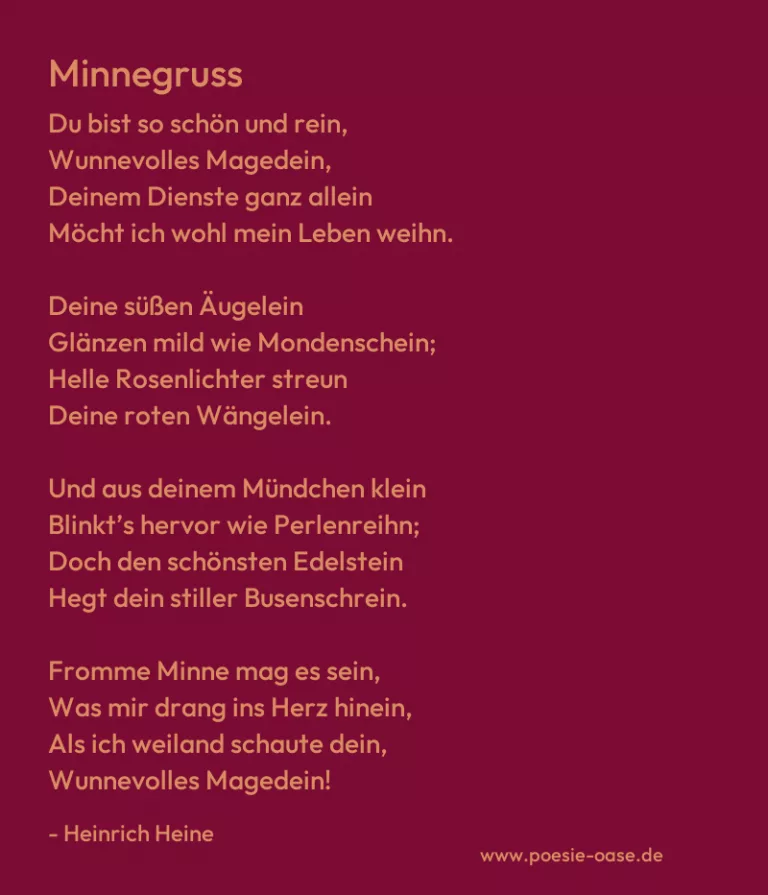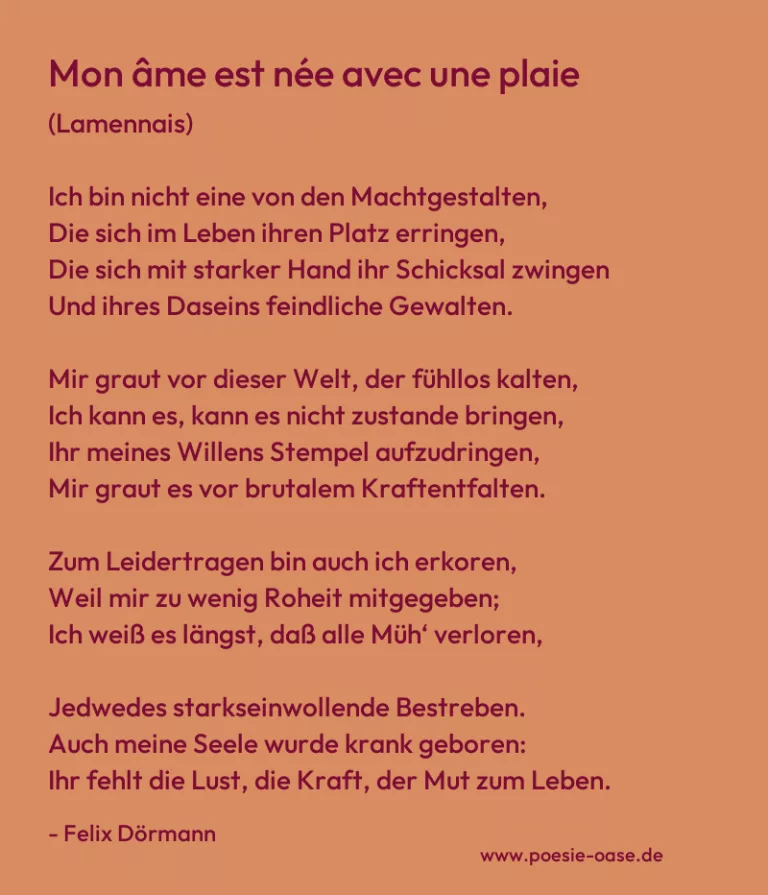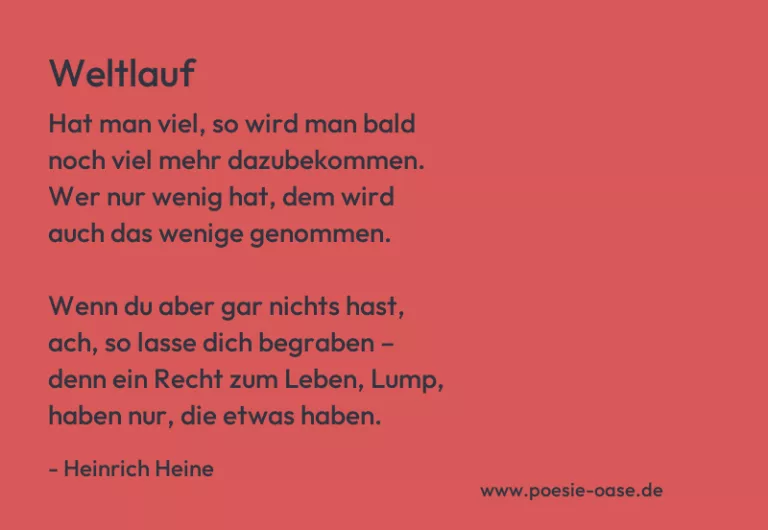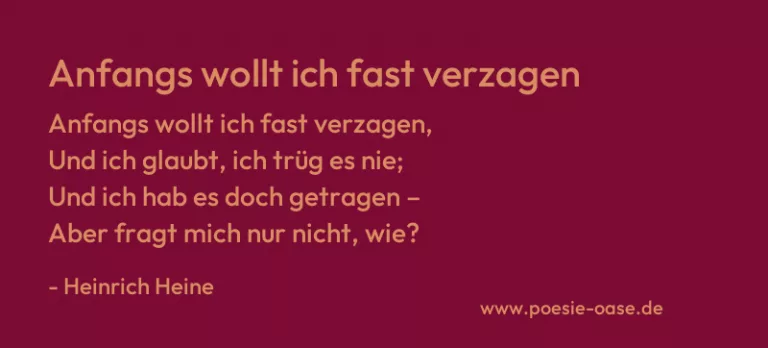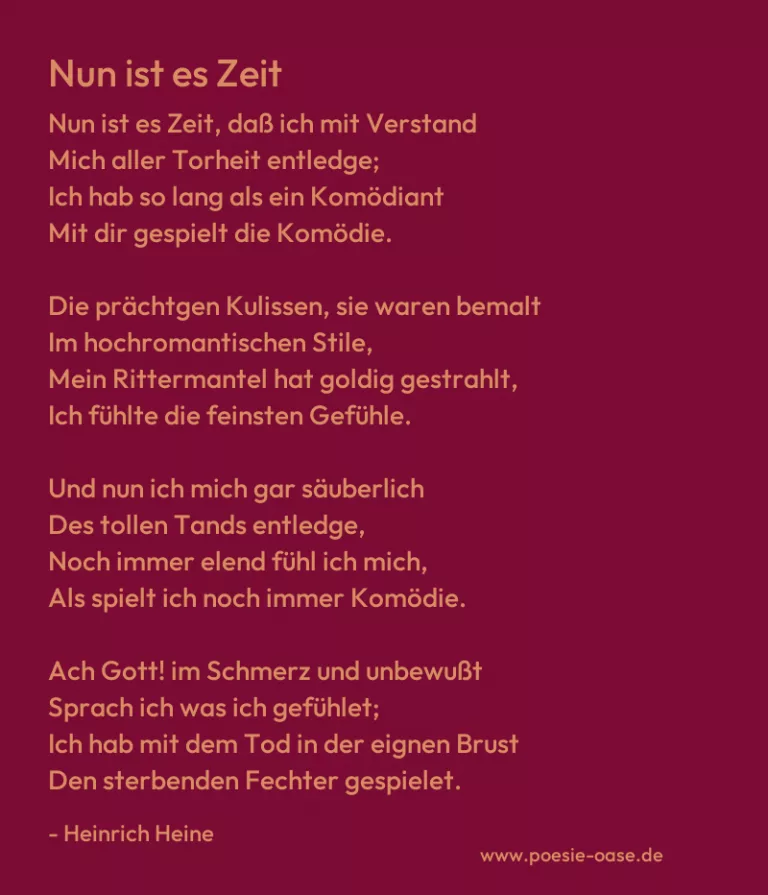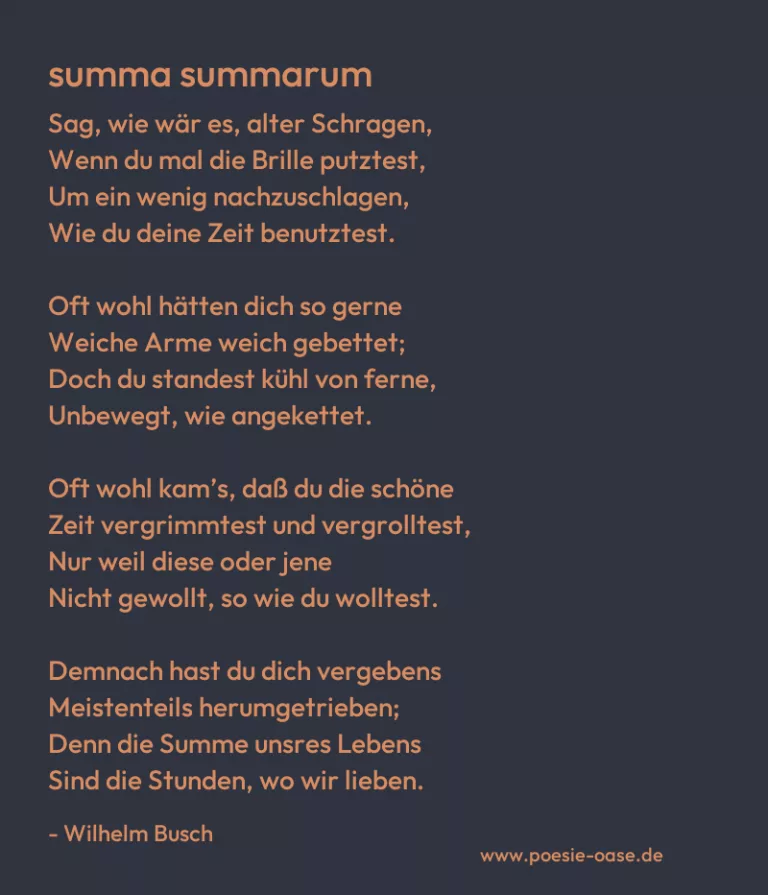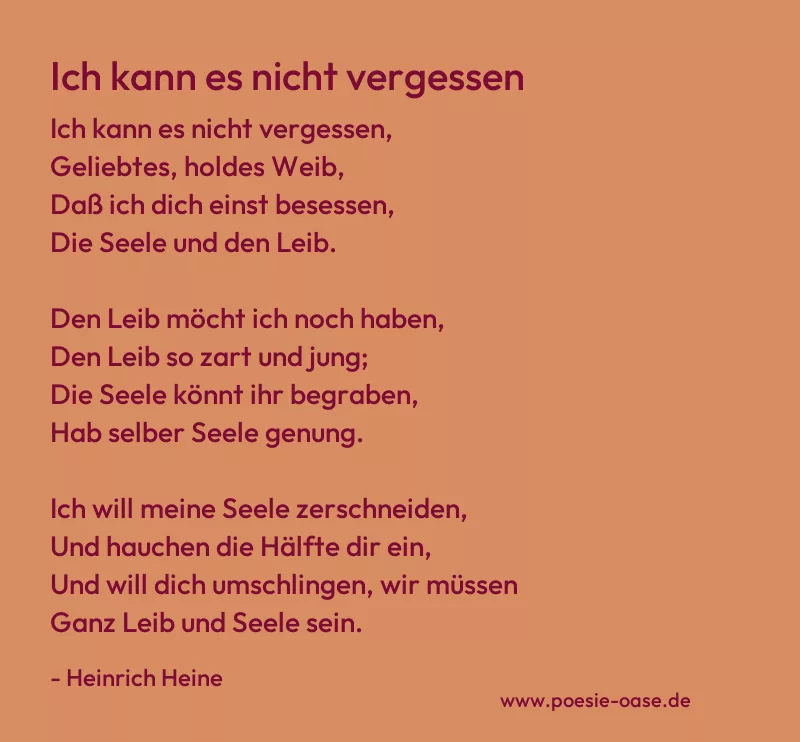Ich kann es nicht vergessen
Ich kann es nicht vergessen,
Geliebtes, holdes Weib,
Daß ich dich einst besessen,
Die Seele und den Leib.
Den Leib möcht ich noch haben,
Den Leib so zart und jung;
Die Seele könnt ihr begraben,
Hab selber Seele genung.
Ich will meine Seele zerschneiden,
Und hauchen die Hälfte dir ein,
Und will dich umschlingen, wir müssen
Ganz Leib und Seele sein.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
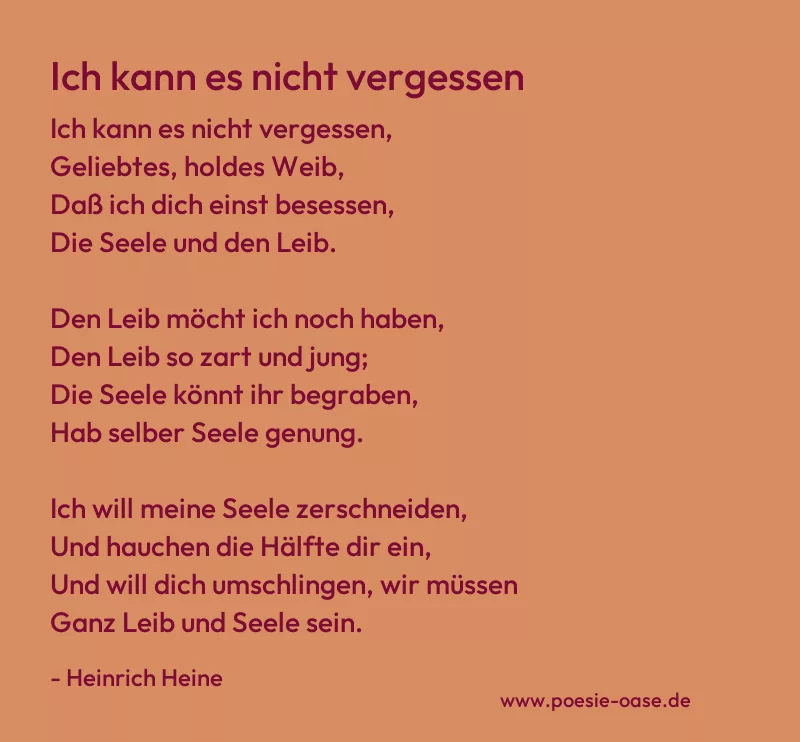
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich kann es nicht vergessen“ von Heinrich Heine thematisiert die leidenschaftliche, fast besessene Liebe des lyrischen Sprechers zu einer geliebten Frau. In den ersten beiden Strophen des Gedichts spürt man eine starke, körperliche Sehnsucht nach der Frau, wobei der Sprecher die körperliche Nähe und das Besitzen von „Leib und Seele“ als den höchsten Ausdruck seiner Zuneigung sieht. Die Formulierung „Ich kann es nicht vergessen“ zeigt eine tiefe, fast quälende Erinnerung an eine vergangene Liebe, die den Sprecher nicht loslässt.
In der zweiten Strophe wird die körperliche Zuneigung noch weiter hervorgehoben. Der Sprecher spricht von dem Wunsch, den „Leib so zart und jung“ wieder zu besitzen. Diese starke Betonung auf den Körper deutet auf eine intensive, körperliche Leidenschaft hin, die den physischen Aspekt der Beziehung über den geistigen oder emotionalen stellt. Doch zugleich scheint er in der letzten Zeile, „die Seele könnt ihr begraben“, seine emotionale Bindung zu relativieren und sogar abzulehnen. Dies könnte darauf hinweisen, dass er die körperliche Verbindung als ausreichend empfindet, während die geistige oder seelische Ebene in den Hintergrund tritt.
In der dritten Strophe schlägt der Sprecher eine noch extremere Vorstellung vor: Er will seine eigene Seele „zerschneiden“ und der Frau „die Hälfte“ einhauchen. Diese Darstellung verdeutlicht, wie sehr der Sprecher die physische und geistige Vereinigung mit der Frau anstrebt. Die Idee, dass er sich selbst aufgeben möchte, um mit ihr eins zu werden, unterstreicht die Intensität seiner Liebe, die sowohl besitzergreifend als auch selbstaufopfernd erscheint. Der Wunsch nach einer völligen Einheit von „Leib und Seele“ geht über das rein Körperliche hinaus, indem er das Konzept der vollständigen Verschmelzung von Körper und Geist betont.
Das Gedicht bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen körperlicher Begierde und emotionaler Erfüllung. Die paradoxe Haltung des Sprechers, der einerseits die Seele als nebensächlich erachtet, aber andererseits eine völlige Verschmelzung von Leib und Seele anstrebt, lässt die Zerrissenheit und Komplexität seiner Gefühle erahnen. Heine spielt hier mit der Idee, dass die körperliche Liebe und die geistige Liebe nicht immer harmonisch miteinander in Einklang stehen und dass das Streben nach einer perfekten Vereinigung möglicherweise zu einer schmerzhaften, selbstzerstörerischen Besessenheit führt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.