Leise zieht durch mein Gemüt
Liebliches Geläute.
Klinge, kleines Frühlingslied,
Kling hinaus ins Weite.
Kling hinaus bis an das Haus,
Wo die Veilchen sprießen!
Wenn du eine Rose schaust,
Sag, ich lass‘ sie grüßen.
Leise zieht durch mein Gemüt
Liebliches Geläute.
Klinge, kleines Frühlingslied,
Kling hinaus ins Weite.
Kling hinaus bis an das Haus,
Wo die Veilchen sprießen!
Wenn du eine Rose schaust,
Sag, ich lass‘ sie grüßen.
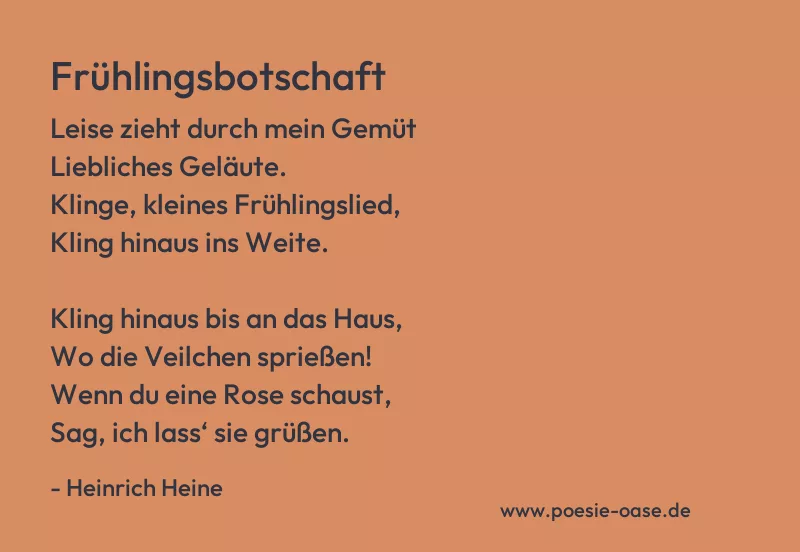
Das Gedicht „Frühlingsbotschaft“ von Heinrich Heine ist eine zarte, fast romantische Reflexion über den Frühling und die damit verbundene Liebe und Hoffnung. Die erste Strophe beschreibt, wie ein „liebliches Geläute“ durch das Gemüt des Sprechers zieht. Diese „Leise“ und „liebliches“ Bewegung verweist auf eine sanfte, innere Stimmung, die mit dem Frühling verbunden wird – einer Jahreszeit des Neubeginns und der Erneuerung. Der Sprecher lässt das Frühlingslied klingen, als wäre es ein Botenruf, der in die Weite hinausdringt, als wollte er die Freude und die Leichtigkeit des Frühlings verbreiten.
In der zweiten Strophe wird das Bild weiter konkretisiert, als das Lied „bis an das Haus“ zieht, „wo die Veilchen sprießen“. Die Veilchen symbolisieren in der Literatur oft zarte und schüchterne Gefühle der Liebe oder Zuneigung, was auf den emotionalen Hintergrund des Gedichts hinweist. Der Frühling wird hier nicht nur als eine äußere Erscheinung der Natur dargestellt, sondern auch als ein inneres Gefühl von Fröhlichkeit und Liebe. Der Hinweis auf die Rose, die der Sprecher in der letzten Zeile grüßen lässt, verstärkt die Symbolik der zarten, blühenden Natur, die sowohl für die Schönheit des Frühlings als auch für die Schönheit der Liebe steht.
Das Gedicht lebt von seiner Leichtigkeit und dem optimistischen Ton, der die Hoffnung auf Erneuerung und den Zauber des Frühlings vermittelt. Heine verbindet die Elemente der Natur mit einem feinsinnigen und persönlichen Ausdruck von Zuneigung und Freude. Die zarte, fast verspielte Formulierung – das „Frühlingslied“ und die „Veilchen“ – lässt die Empfindungen des lyrischen Sprechers in einer unschuldigen und reinen Weise erscheinen, die die Erhebung der Seele durch den Frühling widerspiegelt.
Insgesamt zeigt Heine in diesem Gedicht eine Verbindung zwischen der äußeren Natur und der inneren Gefühlswelt, indem er den Frühling als einen Moment des Erwachens und der zarten, aber tief empfundenen Zuneigung darstellt. Das Gedicht hat eine lyrische Einfachheit, die jedoch in ihrer Schlichtheit eine tiefe emotionale Resonanz entfaltet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.