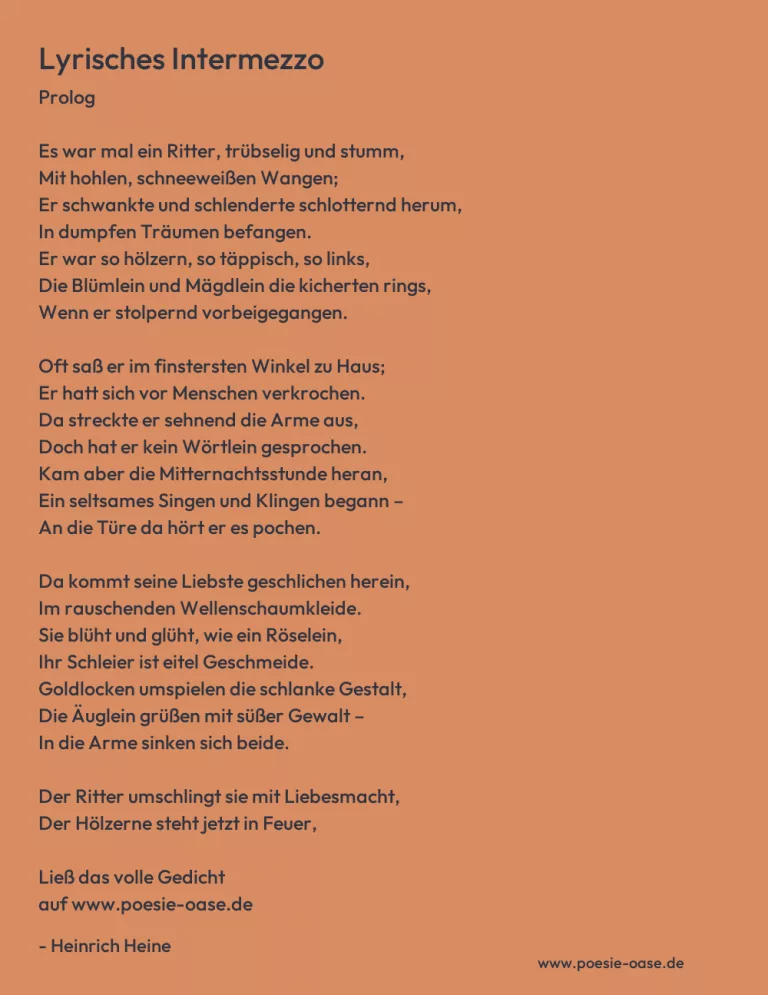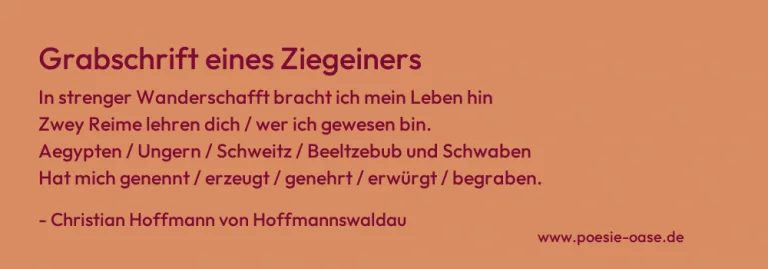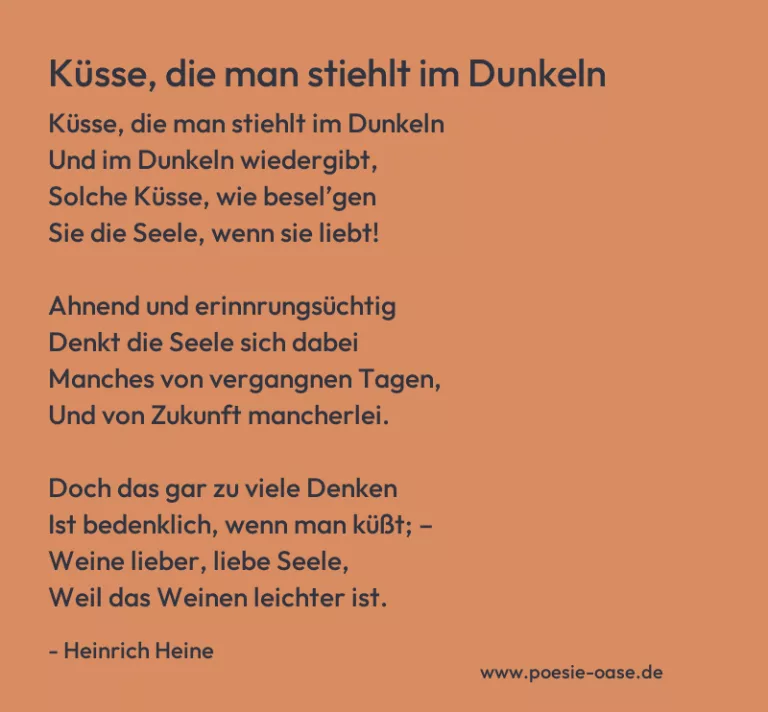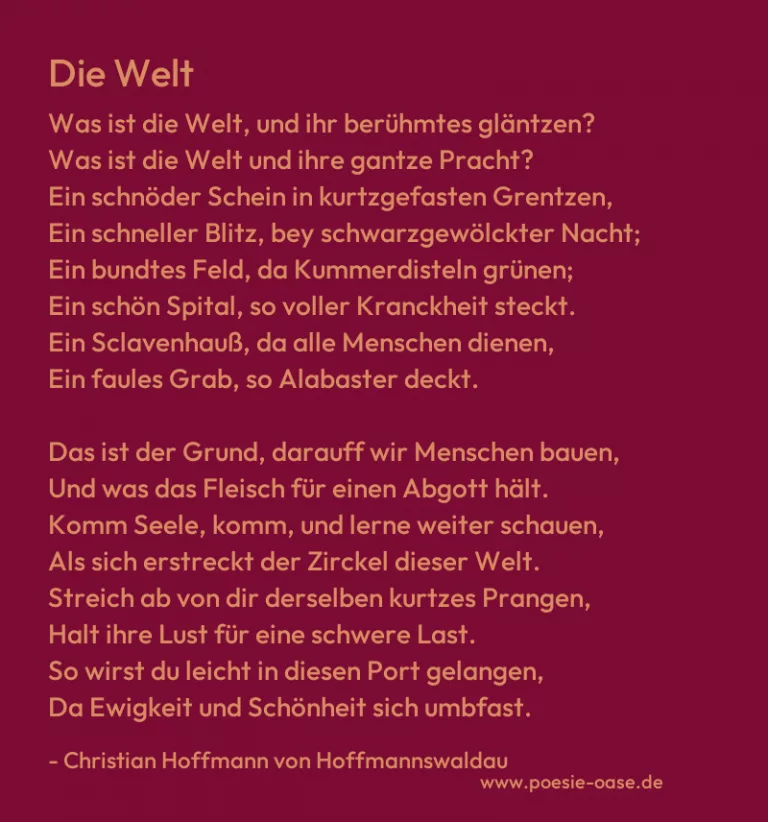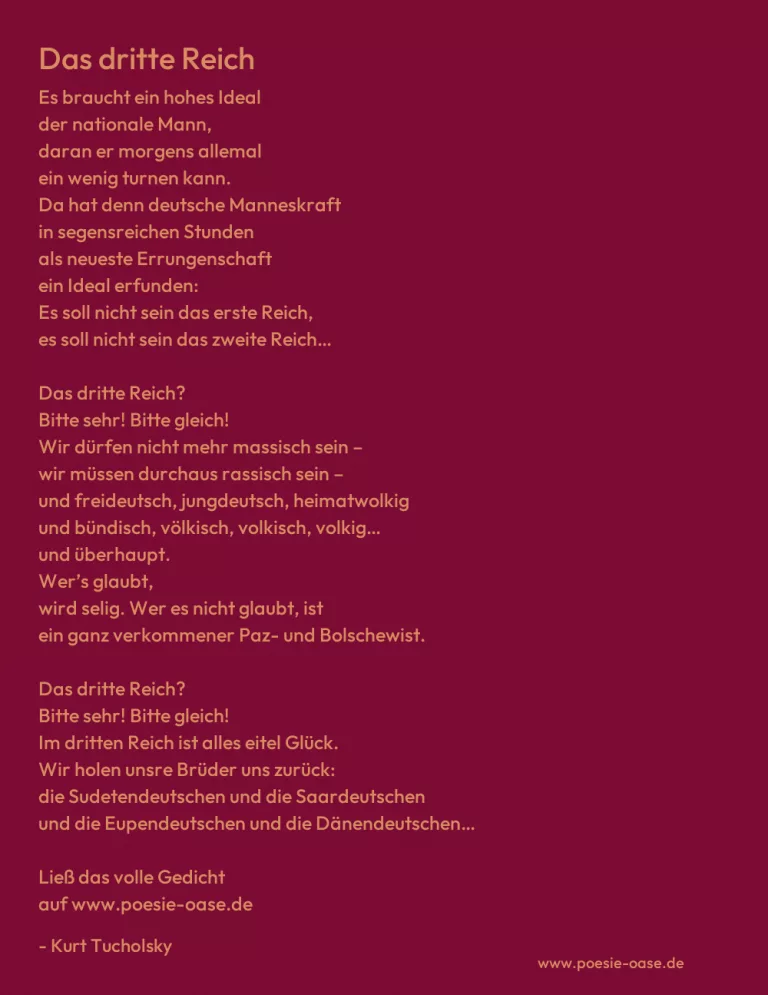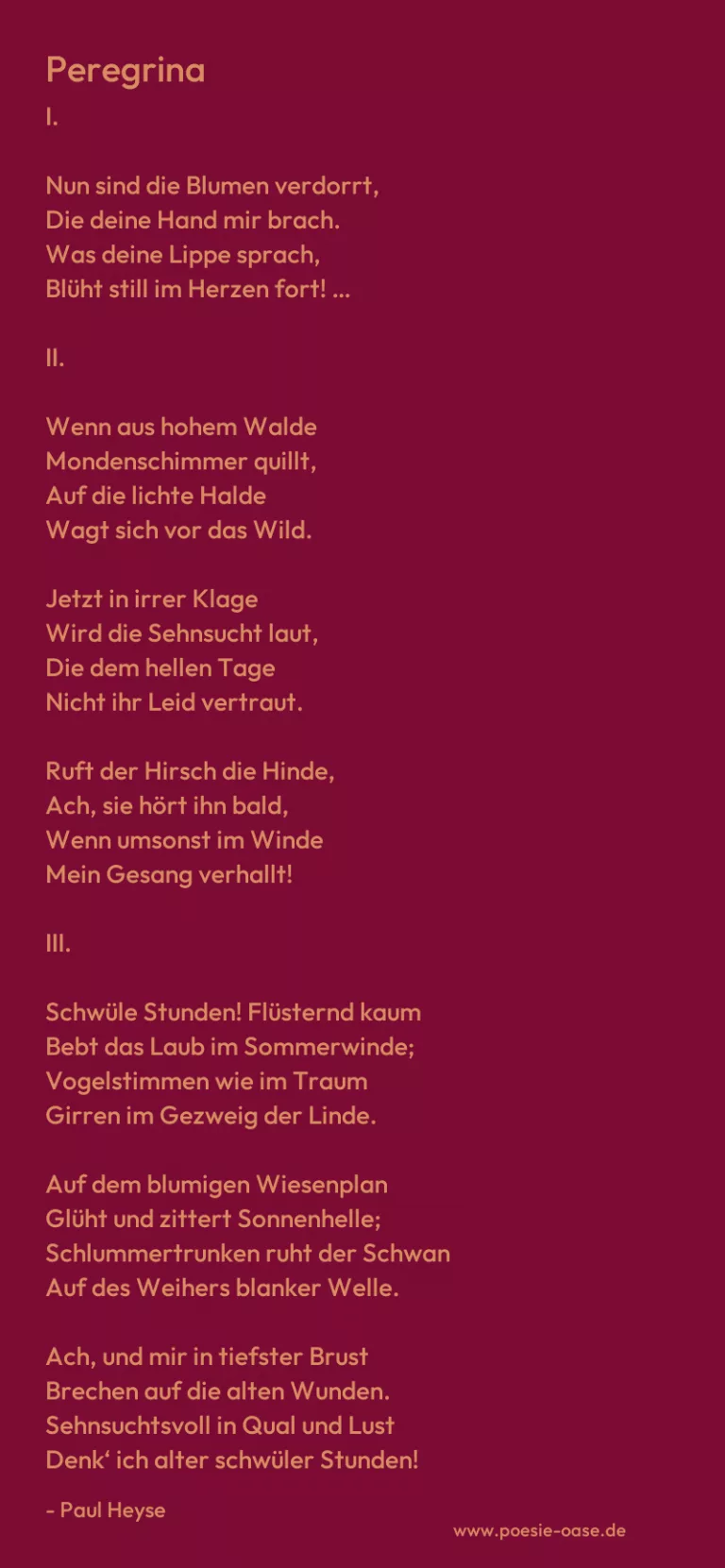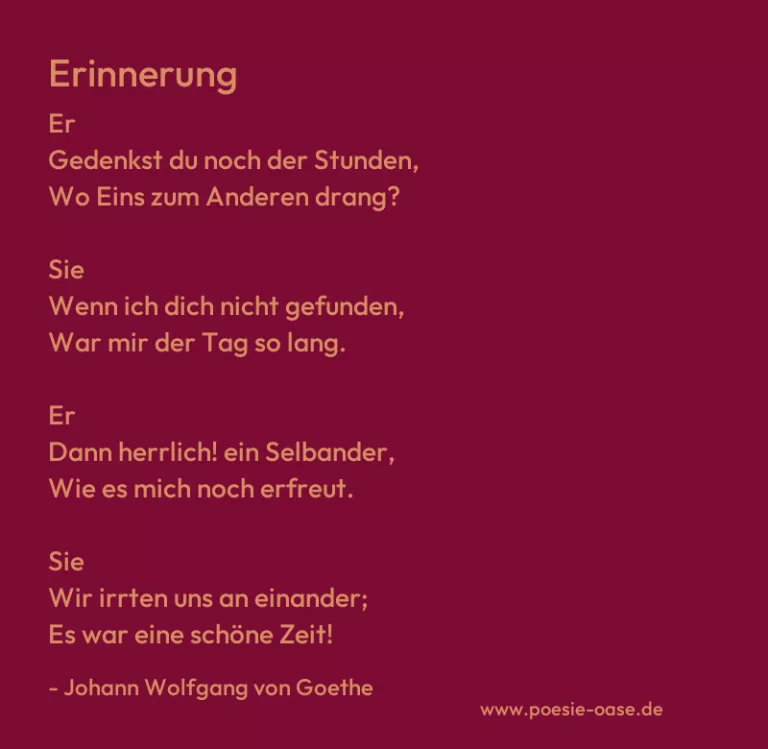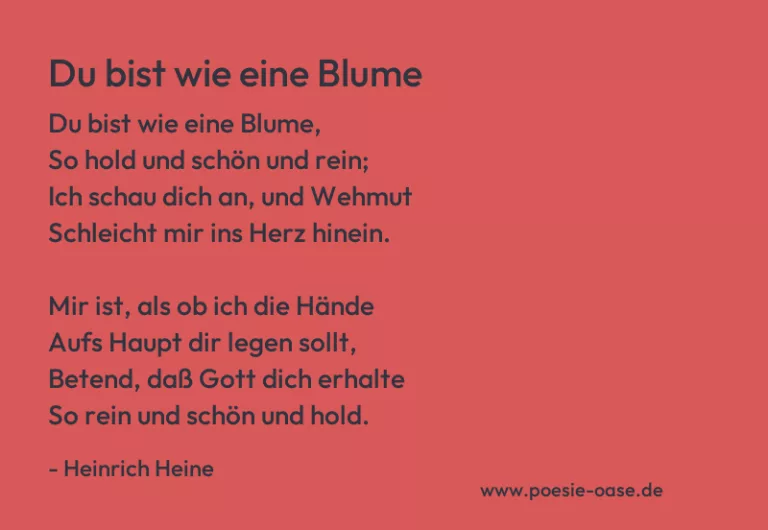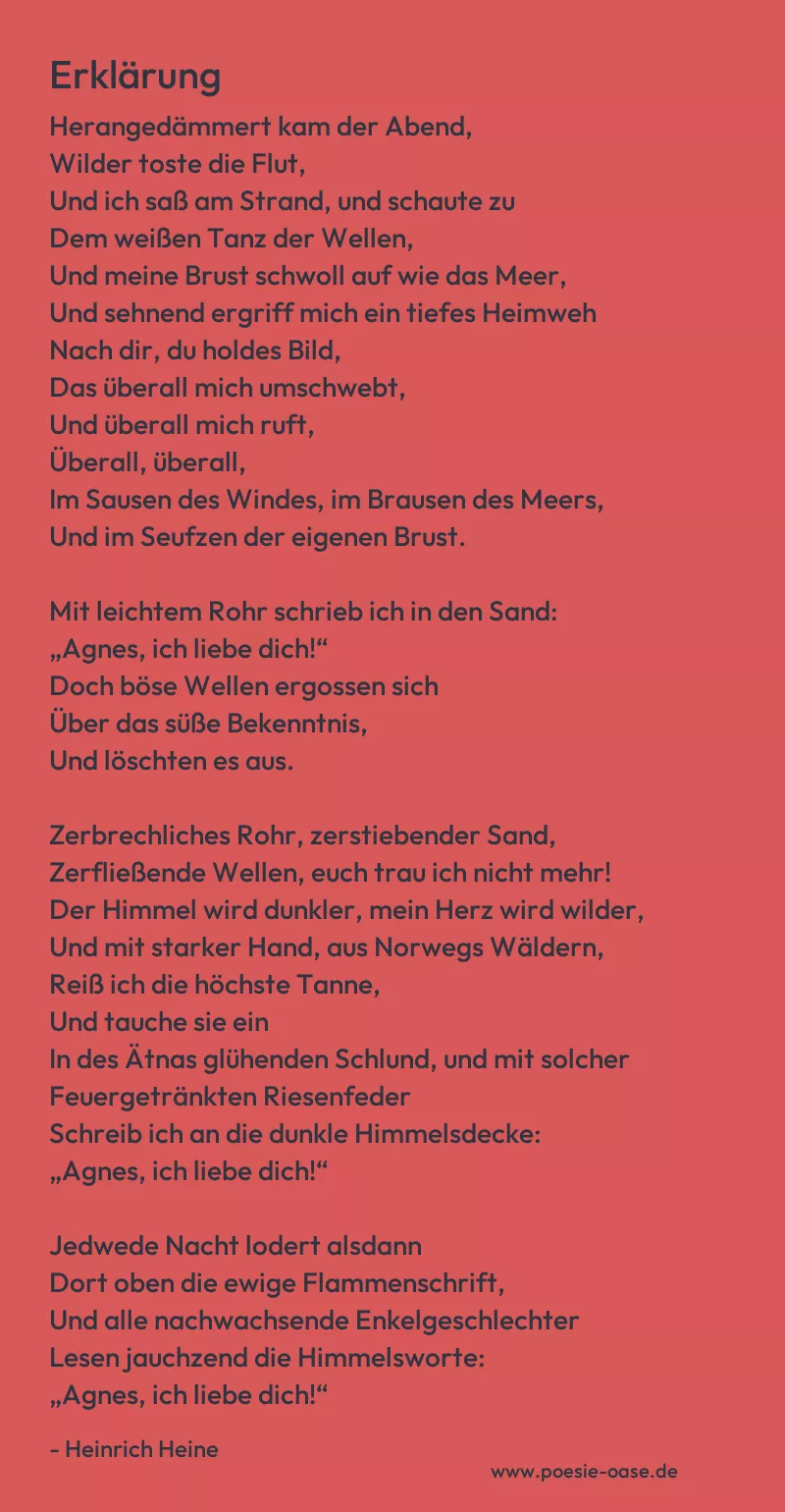Emotionen & Gefühle, Gemeinfrei, Götter, Harmonie, Heimat & Identität, Helden & Prinzessinnen, Himmel & Wolken, Leichtigkeit, Liebe & Romantik, Natur, Sommer
Erklärung
Herangedämmert kam der Abend,
Wilder toste die Flut,
Und ich saß am Strand, und schaute zu
Dem weißen Tanz der Wellen,
Und meine Brust schwoll auf wie das Meer,
Und sehnend ergriff mich ein tiefes Heimweh
Nach dir, du holdes Bild,
Das überall mich umschwebt,
Und überall mich ruft,
Überall, überall,
Im Sausen des Windes, im Brausen des Meers,
Und im Seufzen der eigenen Brust.
Mit leichtem Rohr schrieb ich in den Sand:
„Agnes, ich liebe dich!“
Doch böse Wellen ergossen sich
Über das süße Bekenntnis,
Und löschten es aus.
Zerbrechliches Rohr, zerstiebender Sand,
Zerfließende Wellen, euch trau ich nicht mehr!
Der Himmel wird dunkler, mein Herz wird wilder,
Und mit starker Hand, aus Norwegs Wäldern,
Reiß ich die höchste Tanne,
Und tauche sie ein
In des Ätnas glühenden Schlund, und mit solcher
Feuergetränkten Riesenfeder
Schreib ich an die dunkle Himmelsdecke:
„Agnes, ich liebe dich!“
Jedwede Nacht lodert alsdann
Dort oben die ewige Flammenschrift,
Und alle nachwachsende Enkelgeschlechter
Lesen jauchzend die Himmelsworte:
„Agnes, ich liebe dich!“
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
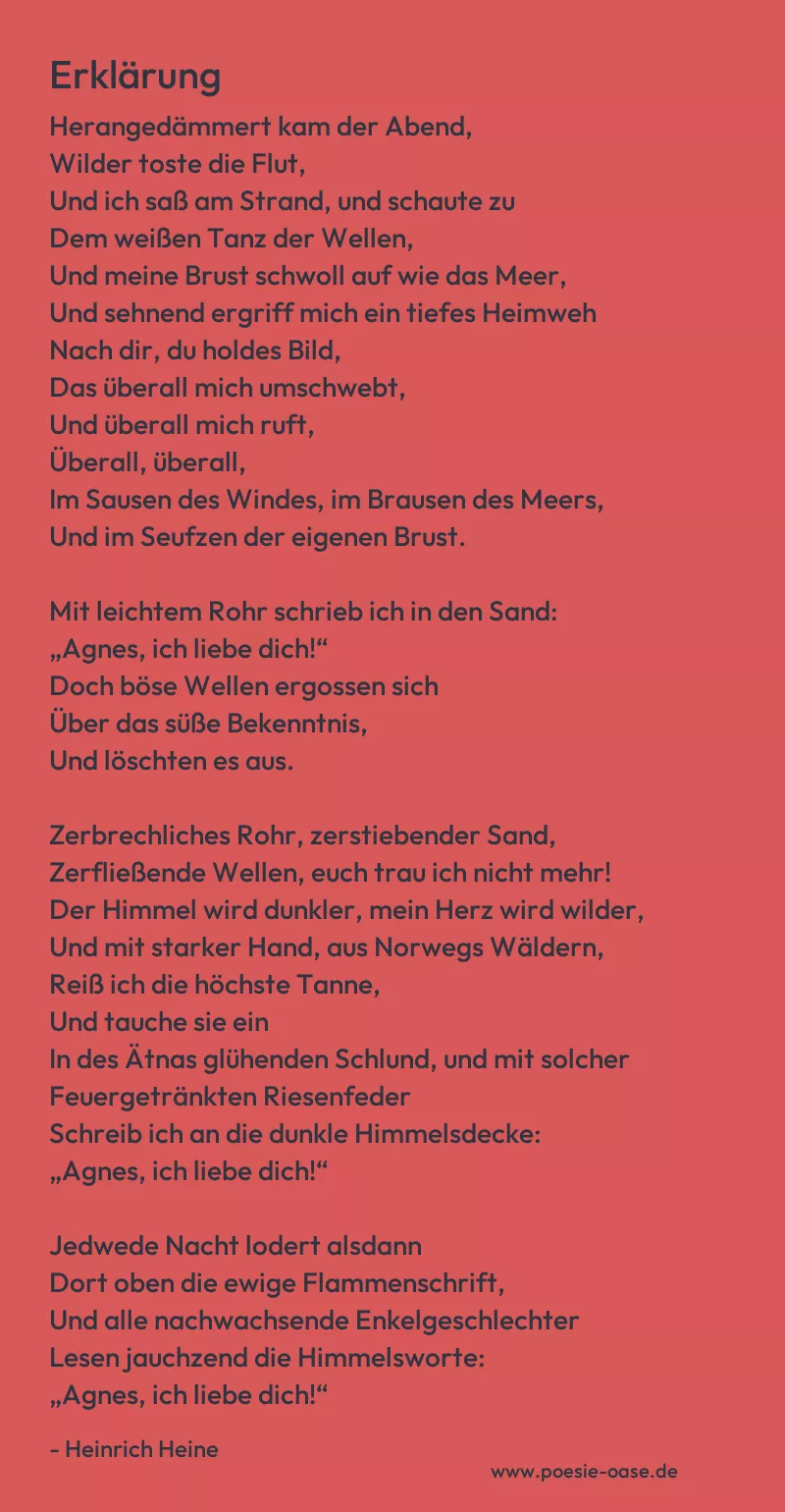
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Erklärung“ von Heinrich Heine zeigt eine leidenschaftliche, fast verzweifelte Liebeserklärung des lyrischen Sprechers an eine Frau namens Agnes. Es beginnt mit einem dramatischen Bild des Abends, in dem die „wilde Flut“ und das „Sausen des Windes“ eine unruhige und emotionale Atmosphäre schaffen. Diese äußeren Elemente spiegeln die innere Erregung des Sprechers wider, dessen Brust sich „wie das Meer“ aufbaut – ein starkes Symbol für das überströmende Gefühl von Sehnsucht und Heimweh.
Die erste Handlung des Sprechers ist, im Sand die Worte „Agnes, ich liebe dich!“ zu schreiben. Doch die „bösen Wellen“ löschen diese Botschaft aus, was als Symbol für die Vergänglichkeit und Unbeständigkeit von menschlichen Gefühlen und Bekenntnissen verstanden werden kann. Die Unsicherheit und die Zerbrechlichkeit seiner Liebe, die mit dem Sand und dem Rohr in Verbindung gebracht wird, führt zu einem Wendepunkt im Gedicht: Der Sprecher entschließt sich, etwas Mächtigeres, Unvergängliches zu schaffen.
In der zweiten Strophe wechselt Heine das Bild und lässt den Sprecher mit einer „starken Hand“ die „höchste Tanne“ aus den norwegischen Wäldern reißen und sie in den „glühenden Schlund“ des Ätna tauchen. Dies ist ein Akt der Leidenschaft und des Übermaßes, bei dem das Zerstörerische und das Schöpferische miteinander verschmelzen. Mit dieser „Feuergetränkten Riesenfeder“ schreibt der Sprecher die Liebeserklärung nicht mehr auf vergänglichem Sand, sondern in den „dunklen Himmel“, was das Maß an Hingabe und Ernsthaftigkeit unterstreicht, das der Sprecher in seine Liebe zu Agnes legt.
Die letzte Strophe verstärkt den dramatischen Charakter der Erklärung. Die ewige Flammenschrift im Himmel wird zu einem Symbol für die Unvergänglichkeit der Liebe des Sprechers. Das Bild der „Himmelsworte“, die von den nachkommenden Generationen „gelesen“ werden, vermittelt die Vorstellung, dass diese Liebe über die Zeit hinaus Bestand hat – ein ewiges, unauslöschliches Bekenntnis. Hier steht der Sprecher nicht nur in einer unmittelbaren, leidenschaftlichen Verbindung zu Agnes, sondern fordert ihre Liebe und Anerkennung auf einer universellen, zeitübergreifenden Ebene. Heine thematisiert hier die Spannung zwischen der Vergänglichkeit menschlicher Handlungen und dem Wunsch, etwas Unvergängliches zu hinterlassen, das in die Zukunft weiterwirkt.
Das Gedicht vereint in seiner dramatischen Bildsprache die Themen von Liebe, Leidenschaft und Unsterblichkeit. Der Sprecher versucht, die Vergänglichkeit menschlicher Emotionen zu überwinden, indem er die Grenzen des Irdischen sprengt und seine Liebe in den Himmel, in die Ewigkeit, schreibt. Diese Thematik, gepaart mit Heines poetischer Intensität, verleiht dem Gedicht eine kraftvolle emotionale Resonanz.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.