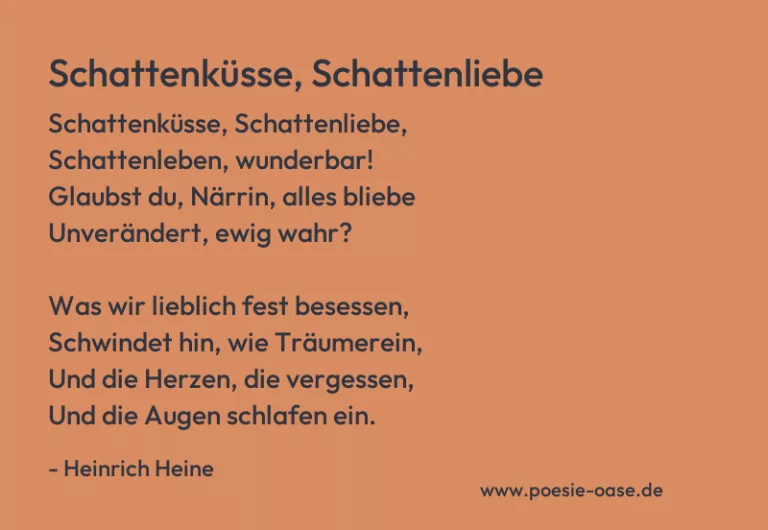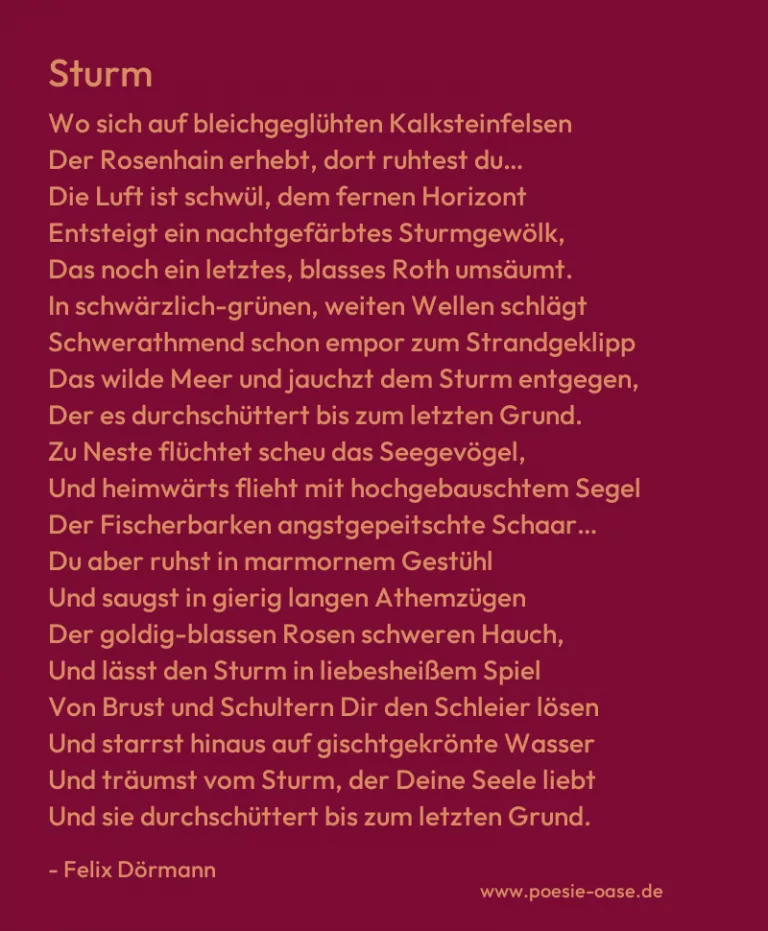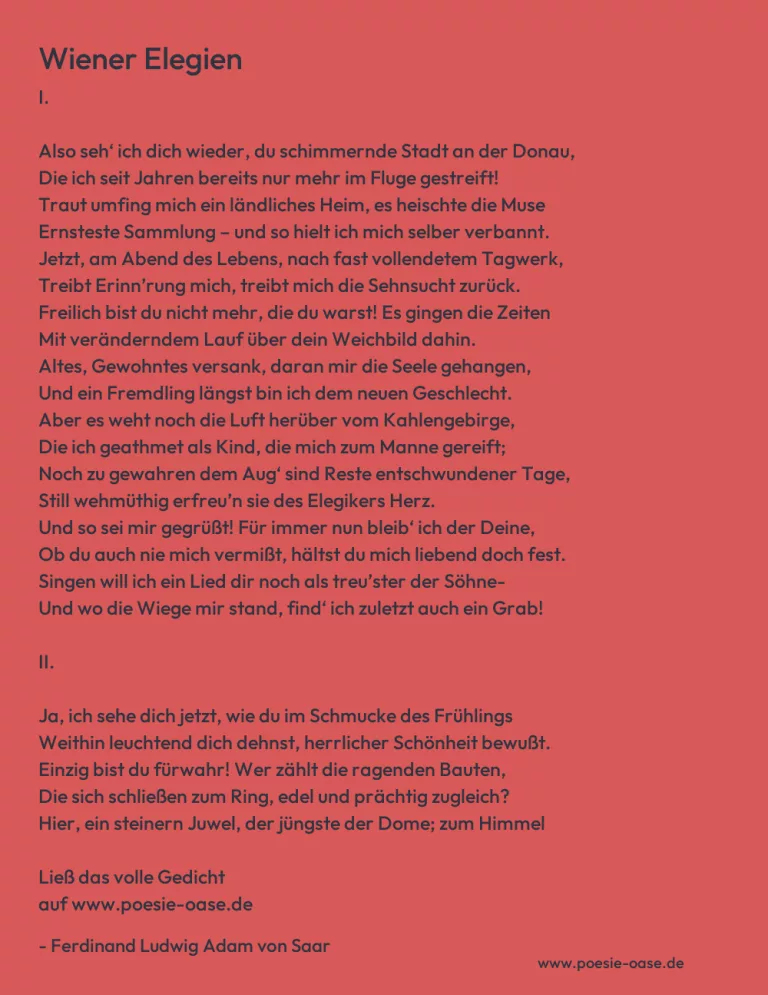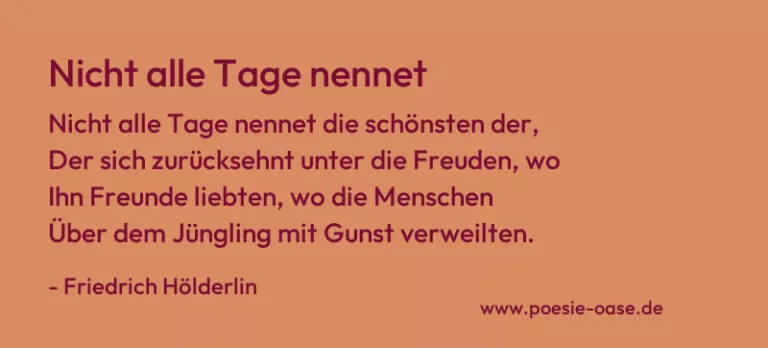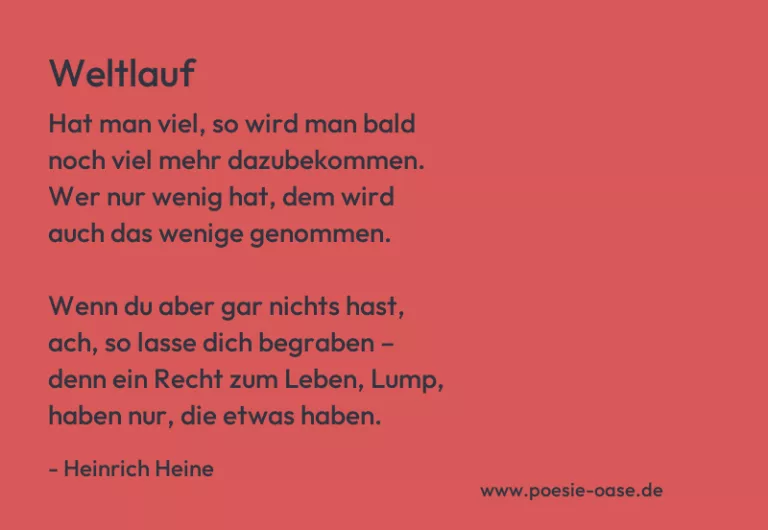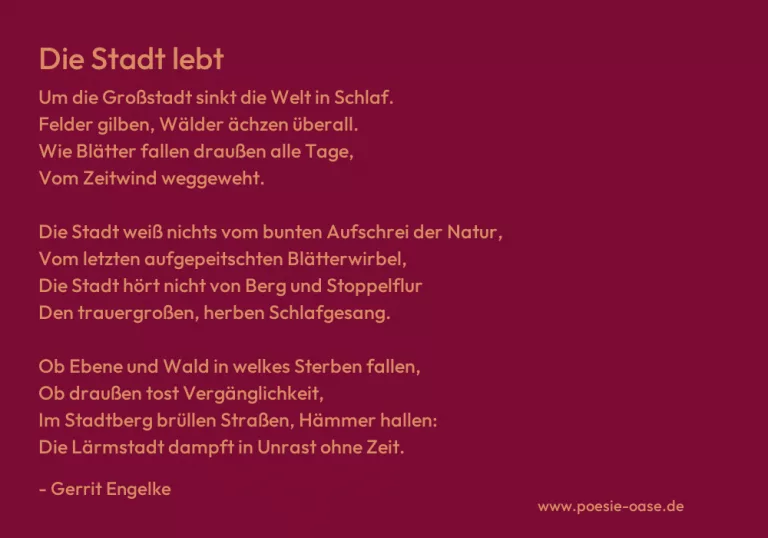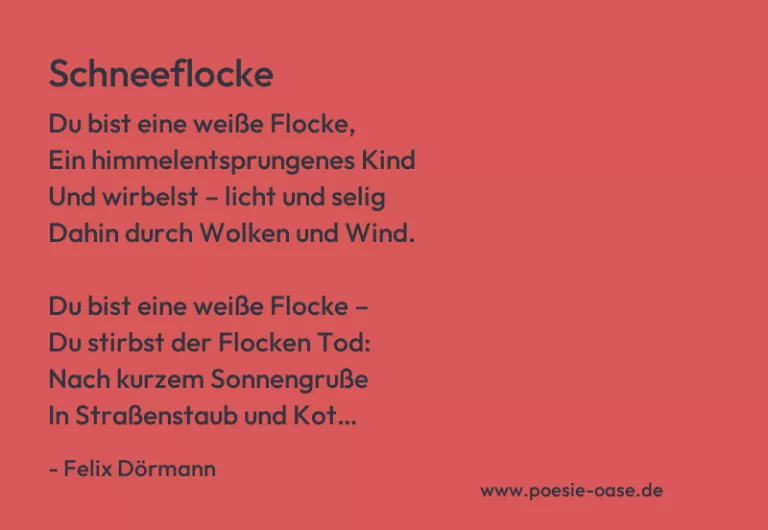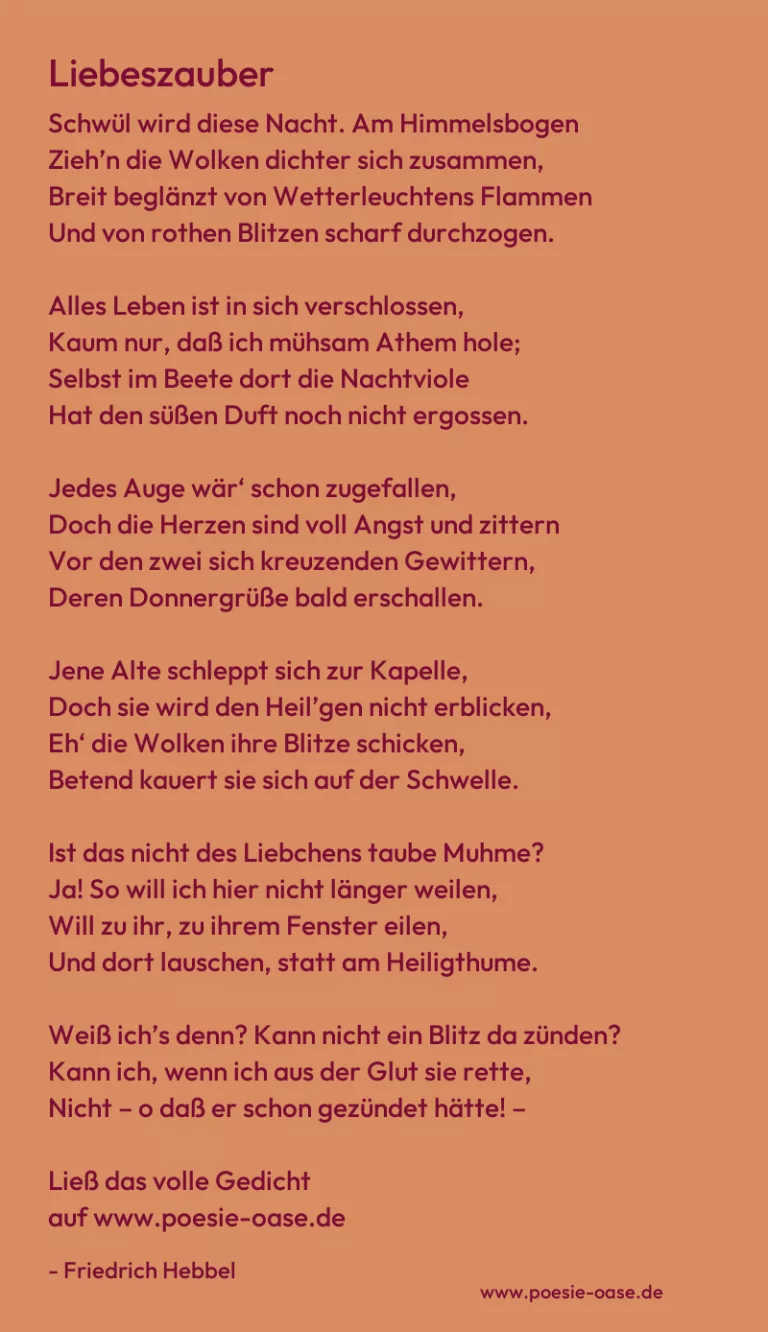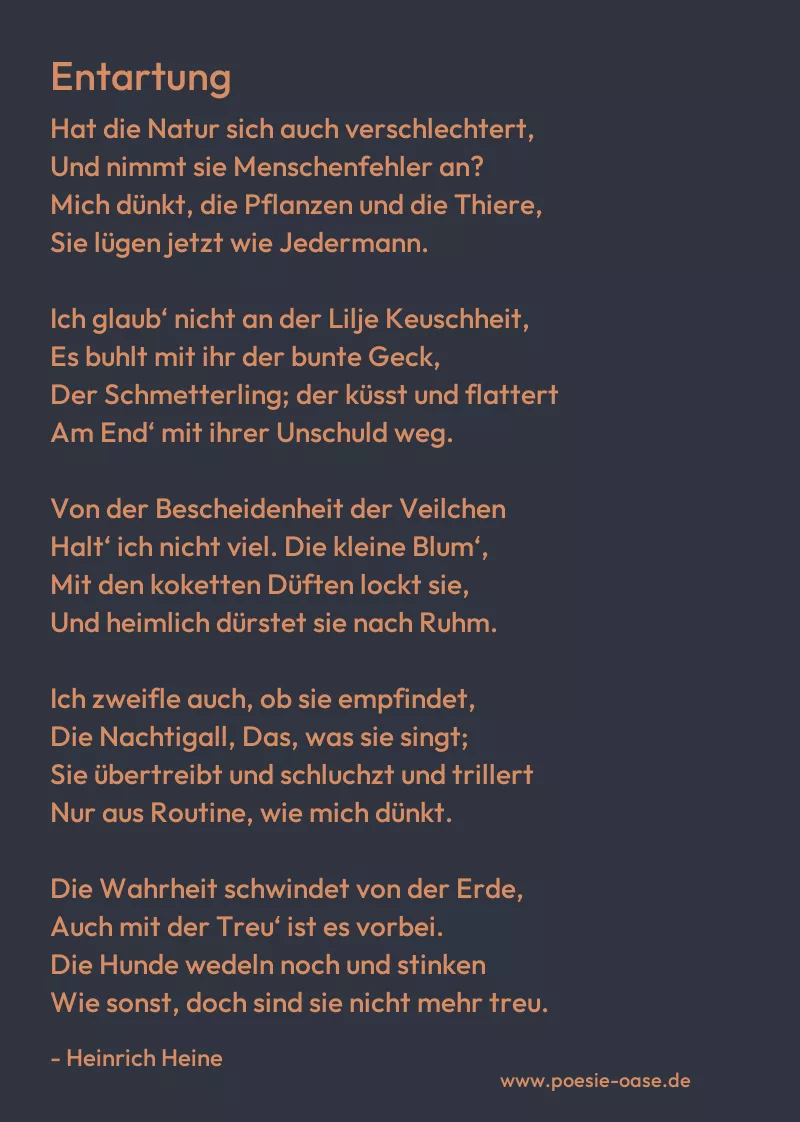Entartung
Hat die Natur sich auch verschlechtert,
Und nimmt sie Menschenfehler an?
Mich dünkt, die Pflanzen und die Thiere,
Sie lügen jetzt wie Jedermann.
Ich glaub‘ nicht an der Lilje Keuschheit,
Es buhlt mit ihr der bunte Geck,
Der Schmetterling; der küsst und flattert
Am End‘ mit ihrer Unschuld weg.
Von der Bescheidenheit der Veilchen
Halt‘ ich nicht viel. Die kleine Blum‘,
Mit den koketten Düften lockt sie,
Und heimlich dürstet sie nach Ruhm.
Ich zweifle auch, ob sie empfindet,
Die Nachtigall, Das, was sie singt;
Sie übertreibt und schluchzt und trillert
Nur aus Routine, wie mich dünkt.
Die Wahrheit schwindet von der Erde,
Auch mit der Treu‘ ist es vorbei.
Die Hunde wedeln noch und stinken
Wie sonst, doch sind sie nicht mehr treu.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
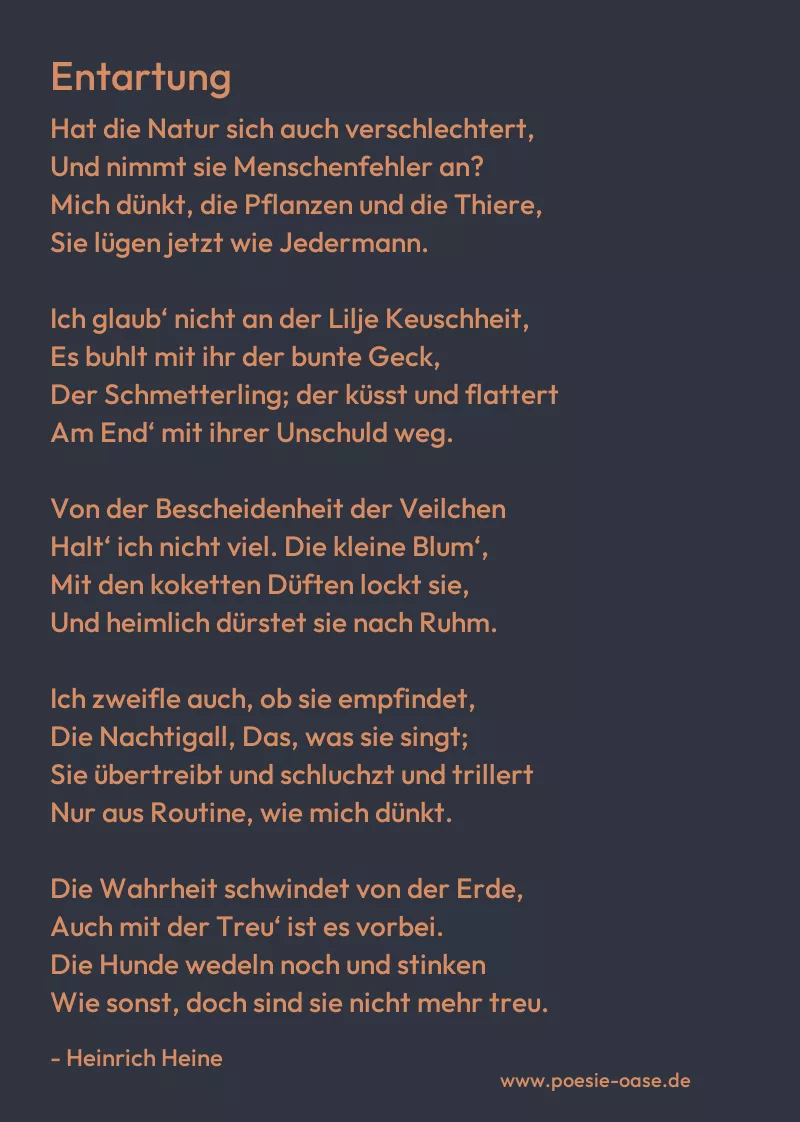
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Entartung“ von Heinrich Heine stellt eine kritische Reflexion über den moralischen Verfall in der Natur und in der menschlichen Gesellschaft dar. Der Sprecher bemerkt eine Veränderung in der Natur, in der selbst die Tiere und Pflanzen, die traditionell mit bestimmten Tugenden assoziiert wurden, nun Eigenschaften zeigen, die diese Werte in Frage stellen. Die anfängliche Frage „Hat die Natur sich auch verschlechtert?“ weist auf eine tiefe Enttäuschung und eine kritische Haltung gegenüber der Veränderung hin, die der Sprecher in der Natur wahrnimmt.
In der ersten Strophe wird das Bild der Lilie, die in der Literatur oft für Keuschheit und Reinheit steht, entstellt. Der „bunte Geck“, der mit ihr buhlt, stellt eine Infragestellung der traditionellen moralischen Werte dar. Der Schmetterling, der „küsst und flattert“ und am Ende die „Unschuld weg“ trägt, symbolisiert die Vergänglichkeit und den Verlust von Reinheit und Unschuld in der Natur, was als eine Allegorie auf den Verlust von Tugenden in der Gesellschaft gedeutet werden kann.
In der zweiten Strophe wird die Veilchenblume, die traditionell mit Bescheidenheit und Zurückhaltung assoziiert wird, als kokettierend und nach Ruhm dürstend dargestellt. Dies verstärkt die Kritik an der Verfälschung von natürlichen und menschlichen Tugenden. Die Veilchen, die mit ihren „koketten Düften“ locken, stehen im Gegensatz zu ihrer klassischen symbolischen Bedeutung der Schlichtheit und Bescheidenheit. Heine benutzt hier die Blume als Metapher für die veränderten Werte in der Gesellschaft.
Die dritte Strophe stellt die Nachtigall in Frage, deren Gesang traditionell als Symbol für Liebe und Schönheit gilt. Der Sprecher zweifelt jedoch daran, ob die Nachtigall wirklich das empfindet, was sie singt, und sieht in ihrem Gesang nur eine „Routine“, was auf eine Entfremdung von echter Empfindung hinweist. Auch in diesem Bild wird der Verlust von Authentizität und echten Gefühlen thematisiert.
Die letzte Strophe bringt die Enttäuschung des Sprechers auf den Punkt: Die „Wahrheit schwindet von der Erde“, und selbst die Hunde, die traditionell als Symbol für Treue und Loyalität gelten, haben diese Tugend verloren. Heine schließt mit der Feststellung, dass die ursprüngliche Reinheit und Treue in der Natur und in der menschlichen Gesellschaft nicht mehr existieren. Die Tiere, die sonst für ihre Ehrlichkeit und Unschuld bekannt waren, werden in diesem Gedicht zu Symbolen der Entartung und des moralischen Verfalls.
Insgesamt nutzt Heine in diesem Gedicht die Natur, um die menschliche Entfremdung und den Verlust von traditionellen Werten zu kritisieren. Der Sprecher sieht die Welt nicht mehr als einen Ort von wahrer Schönheit und Tugend, sondern als eine Entartung, in der selbst die Elemente der Natur ihre ursprünglichen, positiven Eigenschaften verloren haben. Das Gedicht ist eine bittere Reflexion über den moralischen Verfall und die zunehmende Oberflächlichkeit in der Gesellschaft.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.