Jammer, du rührst mich nicht mehr! Denn daß es dem feurigen Proteus
In des Odysseus Arm, der ihn nicht einmal befragt,
Der ihn nur stumm erdrückt und an der Verwandlung verhindert,
Daß es ihm übel behagt, dieses versteht sich von selbst.
Aber, wenn er sich löst und sich die göttliche Freiheit
Wieder erobert, und wär′s auch nur für einen Moment:
Ja, da rührt er mich tief, da fühl′ ich mich doppelt und dreifach
Selber gebunden, da wird eilig das Auge mir feucht.
Zeigt mir ein Bettler die Wunden, so reich′ ich ihm freilich den Pfenning,
Doch ich wusch sie noch nie mild mit der Träne ihm aus,
Aber ich weine dem Lear, und auch nicht, weil es dem König
Mißlich ergeht in dem Stück, nein, weil ein Mensch es gemacht.
Ja, ich will es bekennen, daß selbst die Reiter-Gesellschaft
Mir heut abend den Tau süßer Bewundrung entlockt.
Ist es dem Vogel nicht nah, dies zierliche Mädchen? Der Jüngling,
Beugt er dem dumpfen Gesetz irdischer Schwere sich noch?
Und auf den Schultern des Bruders, das Knäbchen, die Stellungen wechselnd,
Scheint′s nicht lebendiger Ton, welcher nach Laune sich formt?
Gaukeln nicht alle vorüber, wie glänzende Schatten, und zeigen,
Daß der Leib, wie der Geist, frei ist, sobald er nur will?
Ja, und würde auch jedes ein Opfer des kühnsten Versuches,
Den die Begeisterung wagt: stürzt denn nicht Psyche noch schön,
Wenn sie′s im Taumel vergißt, daß sie den trügrischen Fittich
Wieder zerschüttet zu Sand, den sie zu mutig bewegt?
Nach dem ersten Abend bei Franconi in Paris
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
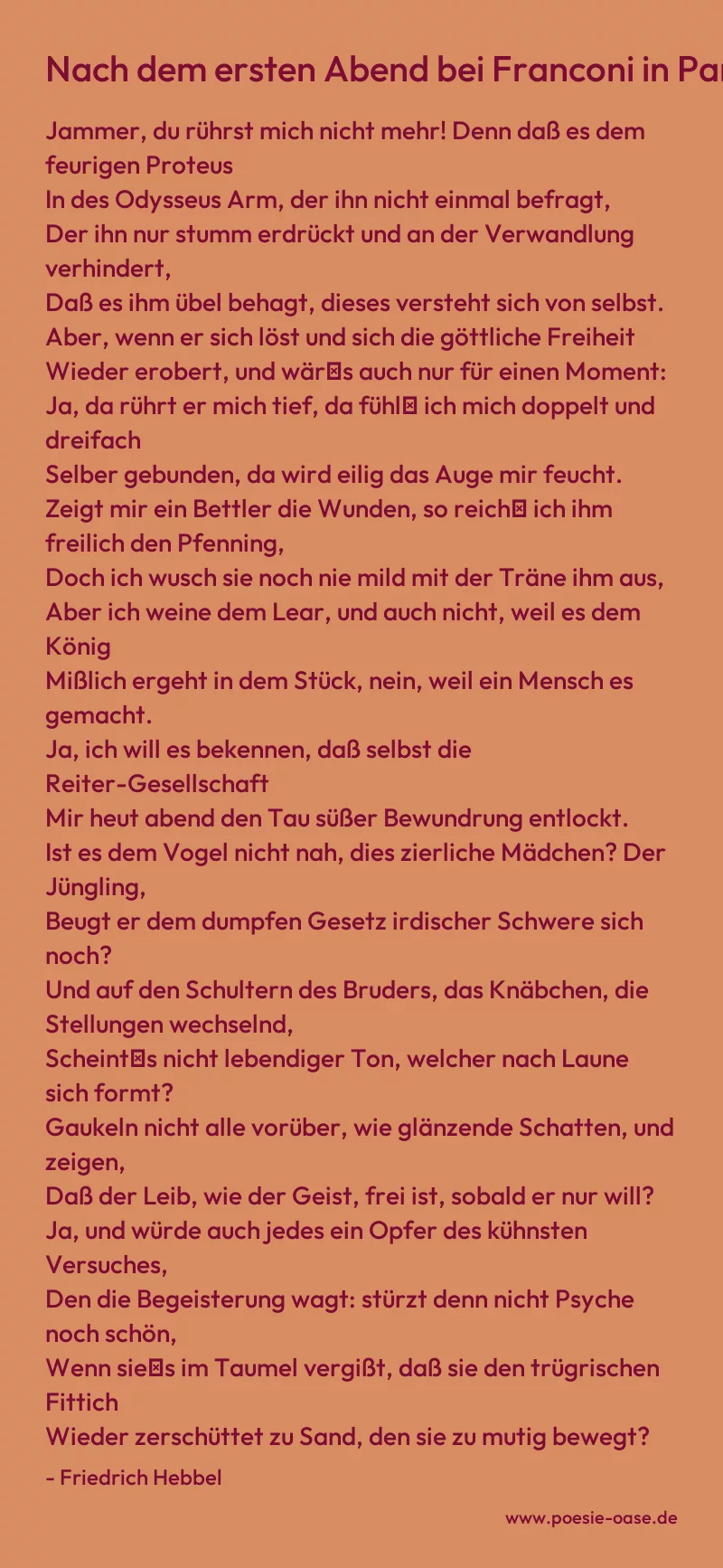
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Nach dem ersten Abend bei Franconi in Paris“ von Friedrich Hebbel ist eine Reflexion über die Kunst und ihre Fähigkeit, tiefe Emotionen und Einsichten in die menschliche Natur hervorzurufen. Es beginnt mit einer Aussage über das Ende der Trauer, die durch das Erleben der Kunst überwunden wird, und wendet sich dann der Bewunderung für die Darbietungen im Zirkus Franconi zu.
Die erste Strophe etabliert einen Kontrast zwischen der eigenen Emotionalität und der Unberührtheit, die Hebbel gegenüber dem Jammer der Welt verspürt. Er vergleicht dies mit der Situation des Proteus, der sich in den Armen von Odysseus nach Freiheit sehnt. Diese Anspielung deutet an, dass der Dichter nicht mehr durch individuelles Leid berührt wird, sondern durch die Fähigkeit, die menschliche Freiheit und Schönheit in der Kunst zu erkennen und zu feiern. Das wirkliche Leid, so die Andeutung, ist die erzwungene Beschränkung und die Verhinderung der Verwandlung, der Freiheit und des kreativen Ausdrucks.
Im zweiten Teil wendet sich Hebbel den artistischen Darbietungen im Zirkus zu. Die Zirkuskunst, insbesondere die akrobatischen Nummern, werden als Inbegriff von Freiheit, Leichtigkeit und Schönheit betrachtet. Die Bilder von Mädchen, Jünglingen und Kindern auf den Schultern des Bruders, die ihre Körper in fließenden Bewegungen darstellen, symbolisieren eine Befreiung von den Zwängen der Schwerkraft und des irdischen Gesetzes. Die Frage, ob die Akrobaten dem „dumpfen Gesetz irdischer Schwere“ unterliegen, deutet auf eine Überwindung der materiellen Welt durch die Kunst hin.
Die letzte Strophe wirft eine Frage nach dem Opfer des „kühnsten Versuches“ auf und vergleicht das Scheitern in der Kunst mit dem Mythos der Psyche, die ihre Flügel verliert. Selbst ein Sturz, ein Fehler oder ein Verlust der scheinbaren Perfektion werden als Teil des künstlerischen Prozesses akzeptiert. Die Kunst wird somit nicht nur als Schau der Schönheit gesehen, sondern auch als eine Arena, in der das Scheitern und der Mut zur Selbstüberschreitung gefeiert werden. Das Gedicht feiert somit die Befreiung des Geistes und des Körpers durch die Kunst, die sowohl die Sehnsucht nach Freiheit als auch die Akzeptanz des Scheiterns beinhaltet.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
