Welch ein herrlicher Kopf! Und einer der vielen des Pöbels!
Macht sie nicht heut das Modell, macht sie es morgen gewiß,
Wenn sie des Hutes bedarf, ihn gegen die Sonne zu schützen;
Welchem Rumpfe jedoch setzt man am besten ihn auf?
Ei, durchmustern wir schnell die Ilias oder die Bibel,
Welche Göttin beliebt? Welche der Heiligen paßt?
Juno? Da wär′ erst die Stirn zu renken, die römisch und kurz ist;
Venus? Du stehst mir im Weg, griechisches Mensch in Florenz!
Heidinnen, packt euch zum Teufel! Ich schenkt′ ihn flugs der Madonna,
Doch die Sixtinische ist leider bis jetzt nicht geköpft.
Vasen werden zerbrochen und Trauerspiele vergiftet,
Aber der Maler erharrt seinen Salvator umsonst.
Sei der Seufzer verziehn! Und nun? Was quäl′ ich mich länger!
Ist nur der Kopf erst gemalt, hängt sich ein Leib wohl daran.
Monolog eines Modelljägers
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
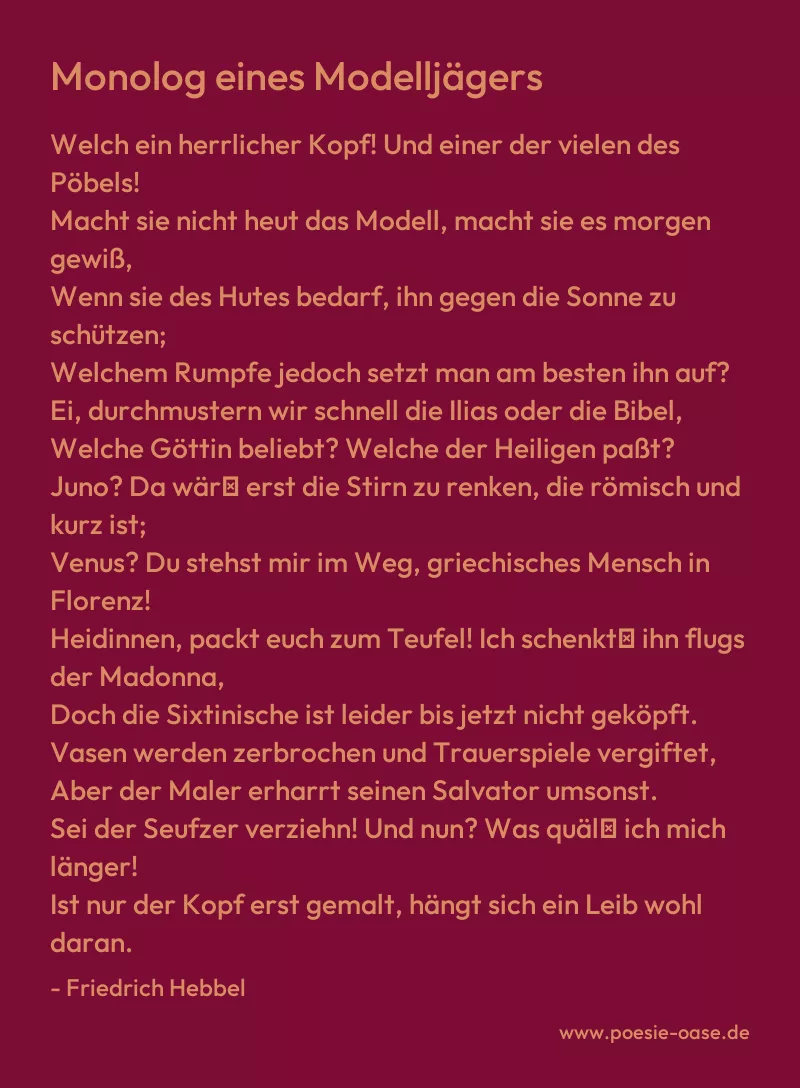
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Monolog eines Modelljägers“ von Friedrich Hebbel zeichnet ein ironisches Bild des Künstlers, der sich mit der Wahl des perfekten Kopfes für seine Malerei abmüht. Der Monolog ist ein Ausdruck der Verzweiflung und des Überdrusses, der durch die scheinbare Unmöglichkeit, eine geeignete Vorlage zu finden, hervorgerufen wird. Der „herrliche Kopf“ des Modells wird als Stellvertreter für das gesamte Kunstwerk betrachtet, wobei die Suche nach dem Ideal die eigentliche schöpferische Tätigkeit in den Hintergrund drängt.
Die Suche des Malers nach dem passenden Kopf ist von einem Wechselbad der Optionen geprägt. Zunächst werden verschiedene historische und mythologische Figuren wie Juno, Venus und Heilige in Betracht gezogen, um die „richtige“ Ästhetik zu finden. Diese Figuren repräsentieren unterschiedliche Epochen und Stilrichtungen, was die Schwierigkeit des Malers verdeutlicht, sich für eine bestimmte Form zu entscheiden. Die Ablehnung jeder Figur, sei es aufgrund von ästhetischen Mängeln oder aufgrund der Verfügbarkeit, zeigt die Unzufriedenheit und die Unfähigkeit des Malers, eine endgültige Wahl zu treffen.
Die Sprache des Gedichts ist ironisch und humorvoll, wodurch die Absurdität der Situation noch verstärkt wird. Der Maler scheint mehr daran interessiert zu sein, das perfekte Modell zu finden, als sich auf seine künstlerische Vision zu konzentrieren. Er klagt über die Zerstörung von Kunstwerken und die Unfähigkeit, seinen eigenen „Salvator“ zu finden, was seine Frustration über die Unvereinbarkeit von Ideal und Realität verdeutlicht. Dies unterstreicht die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, mit denen Künstler konfrontiert sind, wenn sie versuchen, ihre Ideen und Visionen in der Welt der Kunst umzusetzen.
Das Gedicht endet mit einer resignierten Feststellung: „Ist nur der Kopf erst gemalt, hängt sich ein Leib wohl daran.“ Diese Aussage ist ein Zeichen der Kapitulation. Die Bedeutung, die der Auswahl des Kopfes als dem entscheidenden Element zugemessen wurde, verliert ihre Relevanz. Der Maler reduziert sein Ideal auf ein scheinbar belangloses Detail, was auf eine gewisse Ernüchterung hindeutet. Es deutet darauf hin, dass die Perfektion, nach der er strebte, unerreichbar ist und dass das Gesamtkunstwerk nicht von der Perfektion einzelner Teile abhängt.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
