Ich blicke hinab in die Gasse,
Dort drüben hat sie gewohnt;
Das öde, verlassene Fenster,
Wie hell bescheint′s der Mond.
Es gibt so viel zu beleuchten;
O holde Strahlen des Lichts,
Was webt ihr denn gespenstisch
Um jene Stätte des Nichts!
Ich blicke hinab in die Gasse,
Dort drüben hat sie gewohnt;
Das öde, verlassene Fenster,
Wie hell bescheint′s der Mond.
Es gibt so viel zu beleuchten;
O holde Strahlen des Lichts,
Was webt ihr denn gespenstisch
Um jene Stätte des Nichts!
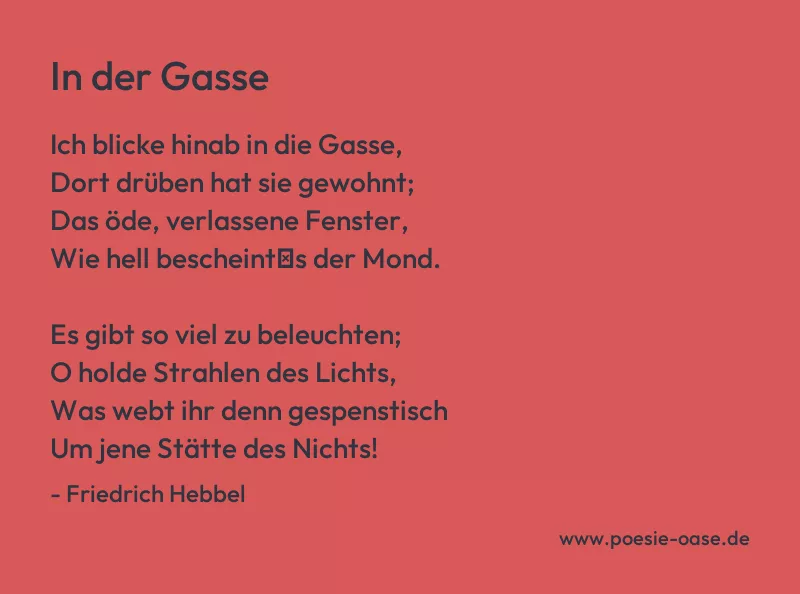
Das Gedicht „In der Gasse“ von Friedrich Hebbel ist eine melancholische Betrachtung über Verlust und die Erinnerung an eine vergangene Liebe. Der Sprecher steht an einem erhöhten Punkt und blickt hinab in die Gasse, wo die geliebte Person einst wohnte. Die Beschreibung des Ortes ist von Anfang an von einer Atmosphäre der Leere und Einsamkeit geprägt, was durch das Adjektiv „öde“ und die Formulierung „verlassene Fenster“ besonders deutlich wird. Der Mond, als stiller Zeuge, beleuchtet das Fenster der Vergangenheit, wodurch die Szene eine zusätzliche, fast gespenstische Qualität erhält.
Die zweite Strophe intensiviert die Emotionen, indem sie die Frage nach dem Sinn dieser Beleuchtung stellt. Die „holde Strahlen des Lichts“ werden direkt angesprochen, wodurch eine Anrede entsteht, die der Leere des Ortes einen Anklang von Dialog verleiht. Die Frage „Was webt ihr denn gespenstisch / Um jene Stätte des Nichts!“ verdeutlicht die Verzweiflung und das Unverständnis des Sprechers. Er sieht die Beleuchtung des Fensters als etwas Unheimliches, fast als eine Geistererscheinung. Das „Nichts“ am Ende der Strophe symbolisiert den Verlust der geliebten Person und die daraus resultierende Leere, die das Leben des Sprechers erfüllt.
Hebbel verwendet eine einfache, klare Sprache, die dennoch reich an Emotionen ist. Die Wahl der Wörter, wie „öde“, „gespenstisch“ und „Nichts“, verstärkt die düstere Stimmung und unterstreicht die Trauer des Sprechers. Der Kontrast zwischen dem hellen Mondlicht und der verlassenen, dunklen Szene unterstreicht die Thematik des Verlusts und der unerreichbaren Vergangenheit. Das Gedicht ist kurz, aber wirkungsvoll, und lässt den Leser die tiefe Melancholie des Sprechers nachempfinden.
Die Bedeutung des Gedichts liegt in der Darstellung der unüberwindbaren Distanz, die durch den Verlust einer geliebten Person entsteht. Der Sprecher ist gefangen in seiner Erinnerung, unfähig, die Vergangenheit zu verändern. Das Gedicht ist ein stilles Zeugnis der Trauer und der Sehnsucht nach einer Zeit, die unwiederbringlich verloren ist. Es reflektiert die menschliche Erfahrung von Verlust und die unendliche Leere, die er hinterlassen kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.