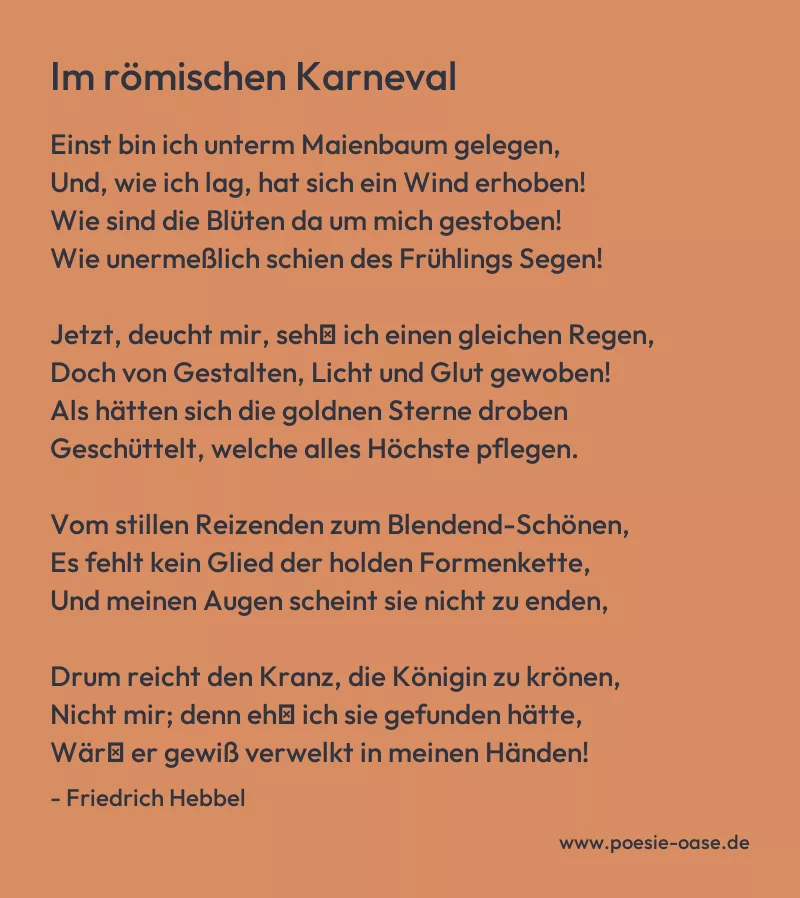Im römischen Karneval
Einst bin ich unterm Maienbaum gelegen,
Und, wie ich lag, hat sich ein Wind erhoben!
Wie sind die Blüten da um mich gestoben!
Wie unermeßlich schien des Frühlings Segen!
Jetzt, deucht mir, seh′ ich einen gleichen Regen,
Doch von Gestalten, Licht und Glut gewoben!
Als hätten sich die goldnen Sterne droben
Geschüttelt, welche alles Höchste pflegen.
Vom stillen Reizenden zum Blendend-Schönen,
Es fehlt kein Glied der holden Formenkette,
Und meinen Augen scheint sie nicht zu enden,
Drum reicht den Kranz, die Königin zu krönen,
Nicht mir; denn eh′ ich sie gefunden hätte,
Wär′ er gewiß verwelkt in meinen Händen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
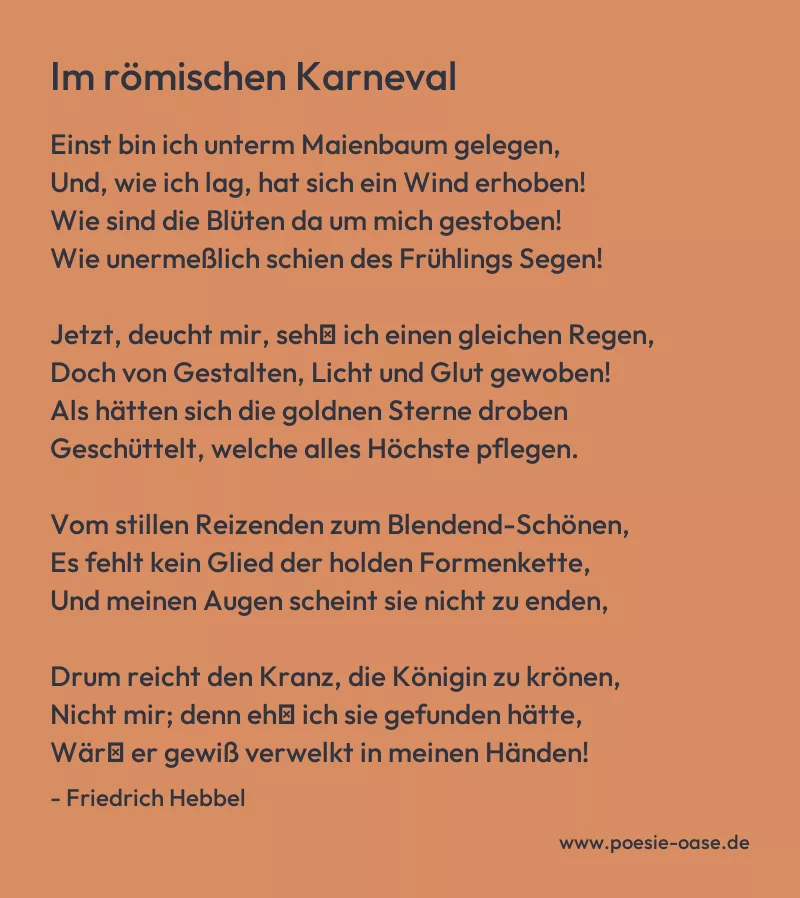
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Im römischen Karneval“ von Friedrich Hebbel beschreibt die Erfahrung eines überwältigenden Erlebnisses, das durch einen Vergleich zwischen einem früheren, idyllischen Naturmoment und dem bunten Treiben des Karnevals in Rom veranschaulicht wird. Der Dichter nutzt Bilder von Blüten und Wind, um die Leichtigkeit und das Glücksgefühl des Frühlings hervorzurufen, um diesen Kontrast zur Pracht des Karnevals zu verstärken. Die ersten vier Verse zeichnen das Bild einer entspannten Szene unter einem blühenden Baum, wo der Wind die Blütenblätter wirbelt und ein Gefühl von grenzenlosem Segen vermittelt.
In der zweiten Strophe wird die Intensität des Karnevals durch Bilder von „Gestalten, Licht und Glut“ ausgedrückt. Die Metapher der „goldnen Sterne droben“, die sich schütteln, deutet auf eine himmlische, nahezu überirdische Schönheit und ein farbenprächtiges Schauspiel hin, das mit dem Erleben des Frühlings verglichen wird. Der Dichter fühlt sich von dem Karneval so überwältigt, dass er die Erfahrung als einen „Regen“ von Schönheit und Pracht wahrnimmt, der sich von der ruhigen Naturerfahrung abhebt. Dieser Vergleich deutet auf eine Steigerung der Sinneseindrücke und Emotionen hin.
Die letzte Strophe offenbart die Erkenntnis des Sprechers, dass er der überwältigenden Schönheit des Karnevals nicht gewachsen ist. Der Übergang vom „stillen Reizenden zum Blendend-Schönen“ zeigt die Breite der Erfahrungen auf, die Hebbel in dem Gedicht umfasst. Obwohl er die Schönheit in vollen Zügen genießt, ist er sich gleichzeitig seiner eigenen Unzulänglichkeit bewusst. Das „Kranz“ wird zum Symbol der Anerkennung oder des Verständnisses der Schönheit, die sich ihm im Karneval offenbart. Die abschließenden Verse drücken die Erkenntnis aus, dass er, als einfacher Betrachter, die Schönheit nicht festhalten kann.
Hebbel nutzt die Form des Sonetts, um die unterschiedlichen Phasen der Erfahrung zu strukturieren: die Erinnerung an die Naturidylle, die Beschreibung des Karnevals und schließlich die persönliche Reflexion. Der Vergleich zwischen Natur und Karneval dient dazu, die Vergänglichkeit und Flüchtigkeit der Schönheit zu betonen. Das Gedicht hinterfragt damit auch die menschliche Fähigkeit, die überwältigende Schönheit der Welt zu erfassen und zu bewahren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.